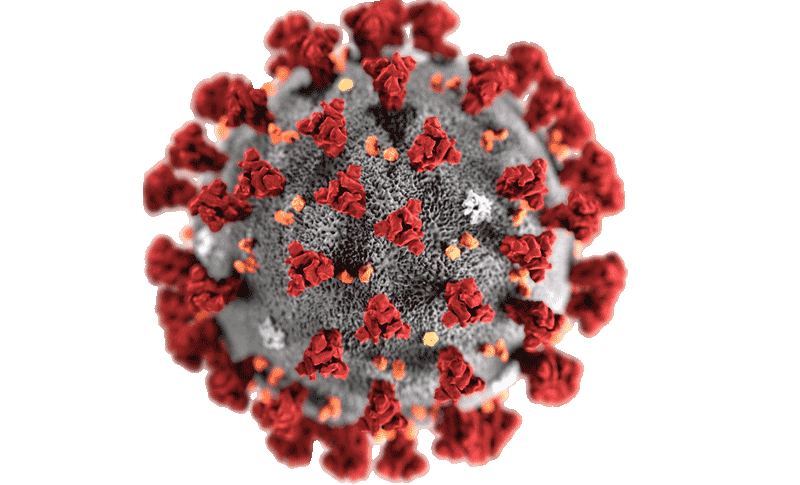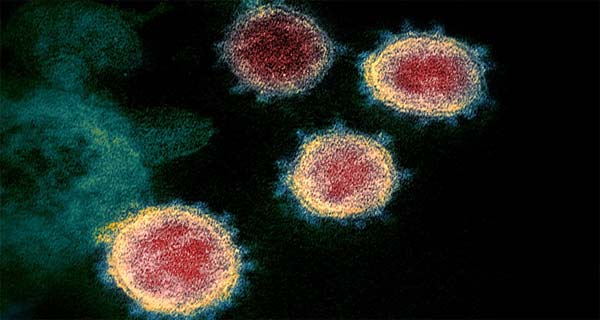Wie verändert Corona unsere Gesellschaft?

Abstand halten, Maske tragen, Kontakte vermeiden: Wie wirkt sich die Viruskrise auf unsere Psyche aus? Verstärkt Corona die soziale Ungleichheit? Wie verändert sich unser Zusammenleben? Dieses Dossier geht der Frage nach, was die gesellschaftlichen Folgen der Pandemie sind.
Hinweis: Dieses Dossier ist ein Archiv-Dossier und wird nicht mehr aktualisiert (letzte Aktualisierung: Januar 2022).
Kurz&knapp: Wie verändert Corona unsere Gesellschaft?
- Die Mehrheit der Deutschen hält die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie für angemessen. Die Akzeptanz der Maßnahmen unterliegt jedoch Schwankungen.
- Die Krise macht soziale Unterschiede sichtbarer und verschärft die Probleme bestimmter Bevölkerungsgruppen.
- Frauen leisten noch mehr unbezahlte Arbeit als vor der Krise, gleichzeitig ist der Beitrag von Vätern zur Care-Arbeit gestiegen. Ob es mehr Gleichberechtigung geben wird oder ob traditionelle Geschlechterrollen festgeschrieben werden, wird sich erst noch zeigen.
- Die häusliche Gewalt nimmt seit der ersten Phase der coronabedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu.
- Auch die Auswirkungen der Viruskrise auf die Psyche sind enorm: die massiven Einschränkungen im Alltag fördern bei vielen Menschen das Entstehen von Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen sowie psychosomatischen Beschwerden.
- Unter der Krise leiden vor allem auch Kinder und Jugendliche. Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass es ihnen seit der Pandemie deutlich schlechter geht.
Was hält die Bevölkerung von den Corona-Maßnahmen?
42 Prozent der für den Deutschlandtrend befragten Wahlberechtigten finden im Januar 2022 die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angemessen - das sind 22 Prozent mehr als noch im Dezember.
Der Blick auf die Statista-Grafik zeigt, dass die Zufriedenheit mit dem Pandemie-Management zuvor stetig abgenommen hatte. Die Akzeptanz der Maßnahmen unterliegt großen Schwankungen.
Wie hat sich die Stimmung verändert?
In der Bevölkerung hat es stets eine hohe Akzeptanz für die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gegeben. Das zeigten mehrere Studien, etwa von Yougov.de, Spiegel.de oder dem ARD-Deutschlandtrend.
Im Laufe des Jahres 2021 waren die Meinungen, ob die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, angemessen sind oder nicht, aber weiter auseinander gegangen und unterliegen Schwankungen. Den erneuten Lockdown im Winter 2020/21 hatten die meisten Befragten in einer Umfrage des ARD-Deutschlandtrends befürwortet. 69 Prozent der Befragten hielten die Maßnahmen für angemessen, 16 Prozent gingen sie nicht weit genug. 64 Prozent sagten, dass sie die Einschränkungen wenig stark oder gar nicht belasten würden. Allerdings fühlten sich von den Haushalten mit Schulkindern 44 Prozent sehr stark oder stark belastet. Auch unter den 18- bis 39-Jährigen fühlten sich überdurchschnittlich viele belastet (45 Prozent).
Freiwilligkeit oder Zwang?
Wie gelingt es, dass möglichst viele Menschen mitmachen und die Corona-Maßnahmen befolgen? Eine Studie der Universität Konstanz hat Ende 2020 ergeben, dass die Menschen in Deutschland mit Corona-Maßnahmen tendenziell eher einverstanden sind, wenn diese auf Freiwilligkeit beruhen. (Quelle: www.deutschlandfunk.de)

An Maskenpflicht gewöhnt
Die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung sind für viele Menschen ein fester Bestandteil des Alltags geworden. Maske tragen ist in der Pandemie zur neuen Normalität geworden. Neun von zehn Deutschen halten die Maskenpflicht für eine angemessenes Mittel zur Eindämmung des Coronavirus, wie etwa Befragungen des Bundesinstituts für Risikobewertung im Sommer 2021 gezeigt haben (Corona-Monitor). Bereits im Juli 2020 hatten 79 Prozent der befragten Bürgerinnen und Bürger in einer Umfrage im Auftrag des ARD-Morgenmagazins angeben, sich an die Maskenpflicht gewöhnt zu haben.
Masken tragen auch nach Corona?
Auch nach der Corona-Pandemie will fast die Hälfte der Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge weiter Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen. Laut einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen im Juni 2021 sprachen sich 44,7 Prozent der Befragten dafür aus. 41,9 Prozent der Befragten wollen dagegen auf das Stück Stoff vor Mund und Nase dauerhaft verzichten. Der Rest ist unentschieden.
Weitere Quellen: Landesregierung Tagesschau zdf.de
Mehrheit laut Umfragen für Corona-Impfpflicht
Um die Impfquote zu erhöhen, wird immer wieder über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht diskutiert. Laut ARD-DeutschlandTrend sprach sich im Dezember 2021 eine deutliche Mehrheit für mehr Beschränkungen und eine allgemeine Impfpflicht aus: 71 Prozent der Befragten befürworten die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht für Erwachsene.
Laut einer Umfrage des ZDF-Politbarometers Mitte Januar 2022 sprachen sich 62 Prozent der befragten Personen für die Einführung einer allgemeinen Pflicht zum Impfen aus.
Mitte 2021 war die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht unter den Deutschen noch umstritten gewesen: 50 Prozent hatten sie abgelehnt.
Wie wirkt sich das Kontaktverbot aus?
Ein Forscherteam der Universität Mannheim hatte während des ersten Lockdowns von März bis Juni 2020 in einer Corona-Studie die Folgen der Einschränkungen durch das Kontaktverbot untersucht und Zahlen geliefert, wie sich die Einschränkungen in der frühen Phase der Corona-Krise auf den Alltag der Menschen auswirkten.
Die Studie zeigt, dass die Häufigkeit, in der sich Menschen mit Freunden oder Verwandten treffen, zunächst bis Ostern deutlich gesunken war. Seit der Osterwoche nahm die Anzahl der sozialen Begegnungen in der Freizeit wieder zu. Die Akzeptanz der Veranstaltungsverbote lag im Juni bei 73 Prozent (Anfang Mai noch bei 90 Prozent), die Schließung öffentlicher Einrichtungen wie Kitas und Schulen befürworteten nur noch 27 Prozent (Anfang Mai 50 Prozent), die Grenzschließungen begrüßen 35 Prozent (Anfang Mai 77 Prozent). Der Anteil der Menschen in Deutschland, die den Schaden für die deutsche Wirtschaft höher einschätzen als den gesellschaftlichen Nutzen der Maßnahmen, nahm im Befragungszeitraum deutlich zu und stieg auf 50 Prozent.
Zu der Corona-Studie gibt es auch einen Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung.
Verstärkt Corona die soziale Ungleichheit?

Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland hat sich in der Corona-Krise als robust erwiesen und ist in den ersten Monaten nach Ausbruch der Pandemie sogar noch gewachsen. Das geht aus dem Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt 2020 der Bertelsmann Stiftung hervor. Doch zugleich macht die Ausnahmesituation soziale Unterschiede sichtbarer und verschärft die Probleme bestimmter Bevölkerungsgruppen.
Für die Studie wurden zunächst im Februar und März 3.010 Personen repräsentativ befragt, 1.000 hiervon dann erneut im Mai und Juni, also nach dem Ende der Kontaktbeschränkungen.
Die Erhebung zeigt, dass es soziale Gruppen gibt, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft systematisch als geringer erleben. In dieser Gruppe sind Menschen mit geringerer formaler Bildung, niedrigem ökonomischem Status und Migrationshintergrund häufiger vertreten. Ebenso finden sich darunter vergleichsweise viele Personen, die allein leben oder alleinerziehend sind. Menschen, die einen geringen Zusammenhalt erleben, haben eine größere Zukunftsangst.
In der aktuellen Krisensituation bestätigen und verstärken sich sozialen Unterschiede - das hatte bereits die Corona-Studie der Mannheimer Universität bestätigt. Insbesondere die unteren Bildungs- und Einkommensschichten sind von den negativen wirtschaftlichen Folgen betroffen. Der Anteil der Personen, die freigestellt werden, in Kurzarbeit müssen oder ihre Arbeit verlieren, ist zudem höher, je niedriger der Bildungsstand ist.
LpB-Web-Talk: Digitale Schule durch Corona. Bildungsziel erreicht o. Bildungsungerechtigkeit verschärft?
Zementiert Corona die Geschlechterungerechtigkeit?
Geschlossene Schulen und Kitas, Eltern im Homeoffice, Teil-Lockdown – alle Familienmitglieder sind zu Hause, das macht Arbeit. Durch die Corona-Krise verändert sich auch das Geschlechterverhältnis in der Sorgearbeit. Bringen sich Väter in der Pandemie nun mehr in die Familienarbeit ein? Oder führt sie dazu, dass es zu einer Retraditionalisierung von Geschlechterrollen und der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen kommt?
Während des ersten coronabedingten Lockdowns im Frühjah 2020 veröffentlichen etwa bei Twitter viele Mütter und Väter unter dem Hashtag #Coronaeltern Erfahrungsberichte aus ihrem Alltag. Diese zeigten: es waren vor allem Frauen und Mütter, die durch die Pandemie-Situation zusätzlich belastet wurden. Sie schultern ohnehin den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit. Aktuelle Studien zeigen aber auch, dass zahlreiche Väter in der Pandemie – teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben – die Betreuung von Kindern übernahmen. (Quelle: Bpb.de)
Care-Arbeit in Corona-Zeiten
Unter Care-Arbeit versteht man allgemeine Tätigkeiten des Sorgens und Sich-Kümmerns - etwa die Pflege Angehöriger, Kinderbetreuung sowie Haushaltstätigkeiten. Sorgearbeit ist meist unbezahlt und wird gesellschaftlich als selbstverständlich angesehen. Als selbstverständlich gilt meist auch die Tatsache, dass diese Arbeit überwiegend von Frauen geleistet wird. Die Tatsache, dass Männer wesentlich weniger Sorge-Arbeit übernehmen als Frauen, wird als „Gender Care Gap“ bezeichnet. Laut UNICEF leisteten Frauen schon vor der COVID-19-Krise weltweit dreimal so viel unbezahlte Care-Arbeit wie Männer: Den UN zufolge steigt diese Art der Arbeit nun exponentiell an. Die Corona-Krise hat erneut eine Debatte um den Wert der Care-Arbeit entfacht (siehe dazu Bpb.de: Care und Corona).
Mehrere Studien haben im Frühjahr 2020 gezeigt, dass sich die Covid-19-Pandemie vor allem auf Frauen negativ auswirkt (Quelle: www.uni-mannheim.de). Es waren zum großen Teil Mütter, die während der Schul- und Kita-Schließungen die Betreuung von Kindern übernahmen und sich in einer doppelten Verantwortung sahen. Für Frauen mit Kindern war es daher schwieriger, ihrer regulären Erwerbsarbeit nachzugehen. Besonders gravierend traf dies Alleinerziehende. Zudem sind in der Pandemie die Arbeitsplätze vieler Frauen, etwa in Gastronomie und Tourismusbranche, stärker von der Krise betroffen als traditionelle Männer-Arbeitsplätze. Die psychische und physische Belastung in Folge der Corona-Pandemie ist deshalb bei vielen Frauen höher. Unter jungen Müttern ist die Lebenszufriedenheit besonders stark zurückgegangen, so eine Untersuchung des DIW Berlin.
Von den negativen Entwicklungen sind Frauen mit geringerem Einkommen und niedrigerem Bildungsstatus stärker betroffen als höher qualifizierte. Laut Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ist der Anteil an Kurzarbeit bei Beschäftigten mit niedriger Bildung doppelt so hoch wie bei Hochqualifizierten. Sie haben auch deutlich häufiger ihren Job infolge von Corona verloren. Gerade Mini-Jobs, die vor allem von Frauen ausgeübt werden, sind in der Krise häufig weggefallen. Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler vermuten daher, dass Frauen wirtschaftlich und sozial gesehen Verliererinnen der Pandemie sein werden. (Quelle: www.wsi.de)
Auch der Beitrag von Vätern ist gestiegen
Auf der einen Seite zeichnet sich ab, dass durch die Pandemie die bestehenden Lücken in der Sorgearbeit (Care Gaps) größer wurden und Frauen noch mehr unbezahlte Arbeit leisteten als vor der Krise. Gleichzeitig ist auch der Beitrag von Vätern zur Betreuung von Kindern und damit zur Care-Arbeit in der Krise gestiegen. Von einer gerechten Verteilung der familiären Care-Arbeit zwischen den Geschlechtern kann aber noch nicht die Rede sein (Quelle: Bpb.de).
Teilweise wurden im Homeoffice neue Möglichkeiten zur Vereinbarung von Arbeits- und Sorgetätigkeit geschaffen. Darin liegt möglicherweise auch eine Chance zur gerechteren Verteilung der Care-Arbeit . So könnten Sorgetätigkeiten in Zukunft flexibler eingeteilt und dadurch zwischen den Geschlechtern fairer verteilt werden. Ob es nach den langen Monaten der Pandemie in unserer Gesellschaft mehr Gleichberechtigung geben wird oder ob traditionelle Geschlechterrollen und Arbeitsteilung dadurch festgeschrieben werden, wird sich erst noch zeigen. Möglicherweise führt ausgerechnet die Corona-Krise zu einem kulturellen Wandel und verleiht damit der Gleichberechtigung einen Schub.
Quellen: Deutschlandfunkkultur.de T3n.de Bpb.de Bpb.de Zeit.de
Homeoffice und Kinderbetreuung

Von einer „patriarchalen Pandemie“ oder einer „Retraditionalisierung“ war während der ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 in Deutschland oft die Rede. Es gab die Befürchtung, die Corona-Krise könnte diese Ungleichheit verstärken, da Schulen und Kindertagesstätten über Wochen geschlossen blieben. Forscher des Wissenschaftszentrum Berlin und der Universität Potsdam schreiben in einem Fachartikel, zu Beginn des Lockdowns hätten Eltern die Sorgearbeit noch kurzzeitig gleichberechtigter aufgeteilt. Allerdings habe sich dieser Trend rasch wieder verflüchtigt. Viele Paare seien wieder zurückgekehrt zu einer vormals ungleichen Aufteilung. Aus ihrer Sicht sei dies vermutlich der Grund, warum Frauen in Umfragen angaben, weniger zufrieden mit Arbeit, Familienleben und dem Leben generell zu sein. (Quelle: www.tandfonline.com)
Forscher der Mannheimer Corona-Studie haben die Werte für subjektives Wohlbefinden vom September 2019 mit denen vom April 2020 verglichen und festgestellt, dass der Lockdown darauf generell negative Auswirkungen hatte. Am stärksten zeigt sich dieser Effekt jedoch bei Müttern, deren Zufriedenheit mit der Arbeit am deutlichsten gesunken ist. Zudem kamen sie zu dem Ergebnis, dass in über der Hälfte der Haushalte die Frauen sich alleine um die Kinderbetreuung gekümmert hätten. (Quelle: www.tandfonline.com)
Wie verändert die Corona-Krise unseren Alltag? Und wie wird sich die Pandemie auf Dauer auf den Einzelnen und die Gesellschaft auswirken? Diesen Fragen gehen auch die Forschenden in der Studie „Sozio-ökonomische Faktoren und Folgen der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland“ (SOEP-CoV) nach. Zum Thema Kinderbetreuung schreiben sie: „Die coronabedingten Schließungen von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen im April und Mai 2020 haben viele Eltern vor eine immense Herausforderung gestellt. Plötzlich mussten Kinder ganztags zu Hause betreut und beschult werden. Wie aktuelle Ergebnisse der SOEP-CoV-Studie zeigen, lag die Hauptlast der Kinderbetreuung während des Lockdowns bei den Müttern. Gleichzeitig investierten die Väter überproportional mehr Zeit in die Betreuung ihrer Kinder als zuvor. Durch das Homeschooling waren insbesondere Alleinerziehende, aber auch weniger gut gebildete Eltern stark belastet.“ (Quelle: https://soep-cov.de)
Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) und Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin, fasst in ihrem Beitrag „Der lange Weg aus der Krise“ die unabhängig voneinander erhobenen Daten der WZB-Studie zum Alltag in Corona-Zeiten, des Sozio-oekonomischen Panels und der Mannheimer Corona-Studie zusammen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Rollenverteilung zwischen Mütter und Vätern in der Zeit der Corona-Pandemie wieder der entspräche, wie sie zu Zeiten der Generation ihrer Eltern und Großeltern gewesen sei. Mütter hätten sich aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen, ihre Arbeitszeit um durchschnittlich noch einmal zwanzig Prozent reduziert, während sich gleichzeitig, die Zeit für Kinderbetreuung und Haushalt erhöht habe.
Alarmierend fände sie, dass „weit überwiegend Mütter diesen Rückzug aus dem Arbeitsmarkt vornehmen, sich um Kinder und Küche kümmern. Väter treten deutlich seltener zurück, bleiben bei ihrem Arbeitsleben, auch dann, wenn sie im Homeoffice arbeiten oder in Kurzarbeit sind“.
Allmendinger sagt: „Wir erleben eine entsetzliche Retraditionalisierung. Die Aufgabenverteilung zwischen Männern und Frauen ist wie in alten Zeiten, eine Rolle zurück. Sie ist entsetzlich, da Frauen heute ganz andere Vorstellungen von einem guten Leben haben als früher.“ (Quelle: www.wzb.eu)
Gender Pay Gap
Noch ist kaum konkret zu sagen, welche Arbeitsmarktwirkungen die Coronakrise auf Frauen und Männer hat. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) deuten erste Erkenntnisse aber darauf hin, dass „im Vergleich zu vergangenen Wirtschaftskrisen“ Frauen diesmal stärker betroffen sind. Das sei vor allem beim Rückgang der geringfügigen Beschäftigung der Fall. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit hingegen belasteten Frauen und Männer etwa gleichermaßen (Quelle: DIW/ Handelsblatt).
Schul- und Kitaschließungen oder deren stark eingeschränkter Betrieb würden zudem den zeitlichen Aufwand für Kinderbetreuung und weitere Bereiche der „Sorgearbeit“ deutlich erhöhen. Schon vor Corona hatten Frauen im Verhältnis zu den Männern deutlich mehr Sorgearbeit übernommen. Es deute zwar einiges darauf hin, dass auch Männer einen Teil der zusätzlichen Betreuungsarbeit übernommen hätten, insgesamt leisteten aber Frauen nach wie vor den deutlich höheren Anteil an der Sorgearbeit – und damit unbezahlte Arbeit.
Auch eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Corona-Pandemie massiv auf die Geschlechterungerechtigkeit auswirkt und bestehende Geschlechterverhältnisse noch weiter zementiert. Frauen tragen demnach die Hauptlast der Care-Arbeit. Der Auswertung zufolge haben in Haushalten mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren 27 Prozent der Frauen, aber nur 16 Prozent Männer ihre Arbeitszeit reduziert, um die Kinderbetreuung zu gewährleisten. Bei Haushalten mit geringerem oder mittlerem Einkommen fällt die Diskrepanz noch größer aus. Das zeige, dass finanzielle Überlegungen bei der Entscheidung, wer von den Eltern Arbeitszeit reduziert, eine wesentliche Rolle spiele. Familien mit wenig Geld könnten es sich häufig nicht leisten, auf das meist höhere Gehalt des Mannes zu verzichten. Paare, die sich so verhalten, handeln individuell unter dem Druck der Krisensituation kurzfristig oft rational. Die Forscherinnen und Forscher warnen aber vor langfristigen Gefahren für die Erwerbsverläufe von Frauen.
Da die ökonomischen Folgen der Krise noch länger spürbar sein werden, könnte eine Rückkehr zur vorherigen Arbeitszeit unter Umständen nicht möglich sein. Somit drohten auf längere Sicht drastische Folgen für das Erwerbseinkommen von Frauen: Die bestehende Lohnlücke zwischen den Geschlechtern dürfte sich durch die Coronakrise noch weiter vergrößern. (Quelle: www.boeckler.de)
LpB-Web-Talk: Zementiert Corona die Geschlechterungerechtigkeit?
LpB-Web-Talk: Zementiert Corona die Geschlechterungerechtigkeit?
Wie wirkt sich Corona auf die Psyche aus?

In der Corona-Pandemie sind nicht nur Risikopatientinnen und -patienten mit körperlichen Erkrankungen gefährdet, sondern auch Menschen mit psychischen Erkrankungen. Verschiedenen Studien zufolge sind außerdem auch Alleinlebende sowie Menschen, die ihre Existenz verloren haben, stark gefährdet, psychisch zu erkranken.
Die massiven Einschränkungen in unserem Alltag – kein Sport, keine sozialen Kontakte, Ausgangsbeschränkungen – fördern bei vielen Menschen das Entstehen von Krankheiten wie Depressionen, aber auch Angst- und Zwangsstörungen sowie psychosomatische Beschwerden. Auch Schlaf- und Erschöpfungszustände nehmen bei vielen Menschen enorm zu – vor allem in den Wintermonaten. Auch die Isolation und eine damit einhergehende Gefahr der Einsamkeit macht vielen Menschen zu schaffen.
Zudem verbreitet sich bei vielen Menschen eine Art Pandemiemüdigkeit. Die Ungewissheit, wann ein halbwegs normales Leben zurückkehrt, macht immer mehr Menschen zu schaffen. Krankenkassen meldeten im Jahr 2020 einen Anstieg an Krankmeldungen wegen psychischer Leiden um sieben Prozent im Vergleich zu den Vorjahren.
Die Bundespsychotherapeutenkammer warnte davor, dass die zweite Welle noch mehr zu psychischen Krisen, depressiven Erkrankungen und Angsterkrankungen führen könnte. Da kein Ende absehbar sei, mache es vielen Menschen extrem schwer, psychisch gesund durch den Winter zu kommen.
Die Psyche als vergessener Aspekt von Covid-19
Auch die WHO-Direktorin für psychische Gesundheit, Devora Kestel, mahnte bei einer virtuellen Pressekonferenz an, die Psyche sei „ein vergessener Aspekt von Covid-19“: „Die Trauer um gestorbene Corona-Opfer, Vereinsamung, Einkommensverluste und Angst lösen psychische Erkrankungen aus oder verschlimmern bereits bestehende Erkrankungen.“ Viele Menschen reagieren demnach auf ihre Probleme mit „erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum, Schlaflosigkeit und Angstzuständen“. Obwohl alle Regionen der Welt betroffen sind, gelang es reichen Staaten laut WHO besser, Dienstleistungen im Kampf gegen psychische Probleme aufrechtzuerhalten. Dreißig Prozent der zwischen Juni und August 2020 befragten Staaten aber gaben an, dass vor allem die Notfall- und Medikamentenversorgung Betroffener unter der Krise litten (Quelle: WHO).
Die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. sowie das Leibniz Institut für Resilienzforschung an der Universität Mainz geben auf ihren Webseiten Ratschläge, wie man während der Coronakrise seine Psyche stärken kann. Viele psychologische Psychotherapeuten und Psychiater bieten seit Beginn der Pandemie auch Telemedizin an oder führen Videotherapien durch.
Mehr Menschen in psychiatrischer Behandlung
Im Auftrag der Betriebskrankenkasse Pronova wurden im Oktober und November 2020 mehr als 150 Psychiater*innen und Psychotherapeut*innen online befragt. 82 Prozent der Ärztinnen und Ärzte stellen bei ihren Patient*innen häufiger Probleme mit Angstzuständen fest. Knapp achtzig Prozent diagnostizieren öfter als zuvor Depressionen. Auch die Fälle somatischer Beschwerden – also psychische Beeinträchtigungen, die sich auf die körperliche Gesundheit auswirken – nehmen zu: Müdigkeit, Erschöpfung und Schmerzen ohne organische Ursache. Bei vielen schlägt sich das in Form von Schlafstörungen nieder. Fast siebzig Prozent der befragten Ärzte beobachten hier eine Zunahme der Fälle seit Beginn der Pandemie.
Insgesamt verzeichnet ein Drittel der befragten Ärztinnen und Ärzte einen vermehrten Zulauf an Patientinnen und Patienten. Bei den niedergelassenen Psychiater*innen sind es 46 Prozent, die mehr Menschen behandeln als zuvor. Ein Viertel verschreibt mehr Medikamente als vor der Krise. Die Gründe, warum sich die Menschen in Behandlung begeben, sind vor allem ein Gefühl der Überforderung, Ängste und familiäre Probleme. Aber auch Alkoholsucht und aggressives Verhalten gegenüber anderen oder Zwangsstörungen zählen dazu.
Besonders im dritten Quartal habe der Andrang in den Praxen zugenommen. Patienten mit psychischen Vorerkrankungen seien in der Krise doppelt anfällig, heißt es in der Studie. 92 Prozent der befragten Fachärztinnen und Fachärzte stellen fest, dass sich die seelischen Leiden ihrer Patient*innen in diesem Jahr verstärkt haben. Das betreffe vor allem Symptome wie Nervosität, Erschöpfung und Antriebslosigkeit (Quelle: www.presseportal.de).
Kinder und Jugendliche leiden besonders

Unter der Krise leiden vor allem auch Kinder und Jugendliche. Die Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche sind vielfältig. Die COPSY-Studie („COPSY“ = „Corona und Psyche“) des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf kam zu dem Ergebnis, dass vor allem Kinder aus einkommensschwachen Familien stark unter der Krise leiden. Viele Kinder und Jugendliche hätten in der Hochzeit der Kontaktbeschränkungen vor allem ihre Freunde vermisst, sich aber auch Sorgen wegen der Schulschließungen gemacht (Quelle: www.uke.de).
Auch weitere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass es seit der Pandemie Kindern und Jugendlichen deutlich schlechter geht. Gaben für die Zeit vor der Pandemie mehr als 95 Prozent der befragten Kinder und Jugendliche aus Deutschland an, mit ihrem Leben zufrieden oder sehr zufrieden gewesen zu sein, so waren dies für die Zeit während der Pandemie nur noch 53 Prozent. Dies zeigt die internationale Studie COVID KIDS, die von Forscherinnen und Forschern der Universitäten Tübingen und Luxemburg durchgeführt wurde.
Neben der Verschlechterung der Lebensqualität und Zunahme psychischer Probleme klagen junge Menschen vermehrt über Vereinsamung und Zukunftsängste. Außerdem haben sie das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse nicht wahlgenommen werden (Studie der Bertelsmann Stiftung). Kinder und Jugendliche sind von der Corona-Krise in vieler Hinsicht betroffen: ihre Freiräume, Entwicklungsmöglichkeiten und sozialen Beziehungen sind eingeengt, hinzu kommen psychische Belastungen und Gefährdungen des Kindeswohl (Quelle: Bpb.de).
Das Schulportal veranschaulicht die wichtigsten Ergebnisse einiger Studien in einer Infografik.
„Die psychische Situation vieler Kinder und Jugendlicher hat sich durch die Pandemie erheblich verschlechtert. Kinder und Jugendliche leiden besonders unter der Krise. Es steht zu befürchten, dass wir heute erst die Spitze des Eisbergs sehen." Gesundheitsminister Manfred Lucha
Für Kinder und Jugendliche, die sich als junge Menschen in einer besonders dynamischen Entwicklung befinden, sowie für ihre Familien, sei die lange Dauer der Pandemie psychosozial besonders schwerwiegend, so das Fazit eines Fachgipfelszur psychischen Situation von Kindern und Jugendlichen in Folge der Corona-Pandemie. Der Fachgipfel fand in Baden-Württemberg im Sommer 2021 statt. Die Teilnehmenden verabschiedeten eine gemeinsame Erklärung. Darin bekräftigten sie, Entwicklungsdefizite von Kindern und Jugendlichen im sozialen, emotionalen und motorischen Bereich in den Blick zu nehmen.
Wie wirkt sich Corona auf das Verhältnis Jugendlicher zur Politik aus?
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf das Leben junger Menschen? Damit hat sich eine Umfrage des Vereins beWIrken befasst und im Sommer 2021 in Niedersachen, Berlin und Baden-Württemberg insgesamt 5242 junge Menschen im Alter von 14 bis 25 Jahren befragt. Die LpB BW hat die Ergebnisse der Umfrage für Baden-Württemberg ausgewertet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den tausenden Kommentaren, die die knapp 2700 befragten Jugendlichen aus dem Ländle zu offenen Fragen hinterlassen haben.
Die Grundaussage ist deutlich. Die Erwartungshaltung der jungen Generation ist, gehört und in politischen Entscheidungen explizit berücksichtigt zu werden und mitreden zu dürfen. Die Politik allerdings muss sich damit befassen, wie junge Menschen künftig besser in Entscheidungsprozesse integriert werden können. Auch wenn sie demografisch gesehen eine kleiner werdende Bevölkerungsgruppe und mehrheitlich Nicht-Wähler:innen sind.
Umfrage 2021: Jugend und die Auswirkungen von Corona
Die 28-seitige Publikation mit den Auswertung der Ergebnisse für Baden-Württemberg ist ausschließlich online erhältlich und steht kostenlos zum Download zur Verfügung.
PDF-Download (5,6 MB)
Jugend 2021. Pandemie, Protest, Partizipation
Ein Beitrag im neuen Heft APuZ „Jugend und Protest“ (2021) der Bundeszentrale für politische Bildung beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Corona-Situation auf das Verhältnis der jungen Generation zur Politik auswirkt. Fühlen sich die Jugendlichen von der Politik ungerecht behandelt? Wie groß ist ihr Protestpotenzial? Wurde es durch die Corona-Pandemie verändert, abgeschwächt oder verstärkt?
Info-Portale
Info-Portale
Was können Eltern tun, um Kindern und Jugendlichen in dieser schwierigen Situation zu helfen? Ein paar Tipps gibt es auf dem Portal Zusammen gegen Corona.
Artikel und Meldungen zum Thema Jugend in Zeiten von Corona bietet das Jugendhilfeportal.
Das Informationsportal "Corona und Du" zur psychischen Gesundheit für Kinder und Jugendliche informiert über das Thema Corona. Dabei erhalten Heranwachsende Rat und Hilfestellungen, damit sie positiv und psychisch gestärkt durch diese Zeit gehen können.
Wie funktioniert die Impfung? Wie schütze ich mich vor einer Ansteckung und vor einem Corona-Koller? Das alles erklären die Beiträge kindgerecht auf der LOGO!-Themenseite Coronavirus.
Während Corona hat die Mediennutzung zugenommen. Das Porta "Ins Netz gehen" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung listet für Jugendliche und ihre Eltern einige Hinweise zur gesunden Mediennutzung auf und gibt alternative Beschäftigungsideen.
Wie übersteht die Familie eine Quarantäne? Wie kann man den Alltag während Corona besser gestalten? Wo finden Kinder und Jugendliche in Not Rat? Eine Auswahl an Tipps für Kinder und Jugendliche in der Corona-Zeit bietet das Familienportal.
Erklärvideo für Jugendliche: Psychische Folgen von Corona
Erklärvideo für Jugendliche: Psychische Folgen von Corona
Informationen der Landeszentrale rund um Corona
Die EU und die Covid-19-Pandemie
Eine existentielle Krise und die Frage nach Zusammenhalt und Solidariät
Webtalks zu Corona
- Gesundheit oder Freiheit - welche Einschränkungen sind verhältnismäßig? (2.7.2020)
- Zwischen Meinungsfreiheit und Verschwörungsmythen (9.7.2020)
- Die Krise trifft nicht alle gleich. Zementiert Corona die Geschlechterungerechtigkeit? (16.7.2020)
- Digitale Schule in der Corona-Zeit: Bildungsziel erreicht oder Bildungsungerechtigkeit verschärft? (23.7.2020)
Letzte Aktualisierung: Januar 2022, Internetredaktion LpB BW