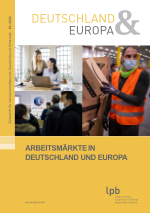Hartz IV – Zeit für Reformen
Wie weit sollen die Änderungen gehen?
Seit dem Inkrafttreten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, umgangssprachlich „Hartz IV“, im Jahr 2005 waren die Regelungen immer wieder Gegenstand heftiger Kontroversen. Im Grunde bestand im politischen Raum seit geraumer Zeit Einigkeit darüber, dass das Regelwerk angepasst werden sollte. Die Frage war aber, wie weit die Änderungen gehen sollen.
Der Beitrag von Prof. Dr. Ulrich Walwei ist Mitte 2022 entstanden und damit noch vor Einführung des Bürgergelds zum 1. Januar 2023. Er beginnt mit einer Beschreibung des Status Quo und der Entwicklung wichtiger Kenngrößen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Danach werden die oben genannten Kritikpunkte genauer adressiert, der jeweilige Forschungsstand dazu zusammengetragen und evidenzbasierte Handlungsoptionen abgeleitet.
Zum Autor: Prof. Dr. Ulrich Walwei
Prof. Dr. Ulrich Walwei ist Vizedirektor am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Der Aufsatz „Hartz IV – Zeit für Reformen“ ist in der Zeitschrift „Arbeitsmärkte in Deutschland und Europa" (2022) der Reihe „Deutschland&Europa" erschienen.
Einführung: Hartz IV – Zeit für Reformen
Die Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, umgangssprachlich „Hartz IV“, war das Kernstück der großen Arbeitsmarktreformen. Seit dem Inkrafttreten im Jahr 2005 sind die Regelungen immer wieder Gegenstand heftiger Kontroversen.
Die Kritik richtet sich auf viele Elemente der Grundsicherung. Das Niveau der sozialen Absicherung sei unzulänglich und mit Armutsrisiken verbunden. Die Lebensleistungen von Menschen würden zu wenig berücksichtigt. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende setze auf ein zu strenges und teils überzogenes Fordern. Es werde zu wenig und nicht immer passgenau gefördert und insbesondere gebe es zu wenige Angebote für arbeitsmarktferne Gruppen. Schließlich sei die Anrechnung von Erwerbseinkommen nicht großzügig genug.
Im Grunde besteht im politischen Raum seit geraumer Zeit Einigkeit darüber, dass das Regelwerk angepasst werden sollte. Die Frage ist aber, wie weit die Änderungen gehen sollen. Reichen kosmetische Korrekturen, braucht es eine systematische Weiterentwicklung oder gar eine fundamentale Neuausrichtung?
Der Koalitionsvertrag der neu gewählten Bundesregierung kündigt einen Umbau des bisherigen Regelwerks an (Koalitionsvertrag 2021 – 2025). Anstelle der bisherigen Grundsicherung für Arbeitsuchende soll ein „Bürgergeld“ kommen. Im Regierungsprogramm werden viele der bereits genannten Kritikpunkte aufgegriffen. Soll es aber bei den Reformen nicht zu einem Blindflug kommen, können wissenschaftliche Erkenntnisse ein wichtiger Orientierungspunkt für die Reichweite möglicher Anpassungen sein.
Der Beitrag beginnt mit einer Beschreibung des Status Quo und der Entwicklung wichtiger Kenngrößen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Danach werden die oben genannten Kritikpunkte genauer adressiert, der jeweilige Forschungsstand dazu zusammengetragen und evidenzbasierte Handlungsoptionen abgeleitet.
Hartz IV: Institutioneller Rahmen und jüngere Entwicklungstendenzen
Mit den Hartz-Reformen wurde im Jahre 2005 die Grundsicherung für Arbeitsuchende eingeführt. Dahinter stand die Zusammenlegung der früheren Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe. Die betreffenden Regelungen im Sozialgesetzbuch II (SGB II) zielen auf eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik, die durch Fördern und Fordern auf Eigenverantwortung und Eigeninitiative setzt. Die Arbeitsmarktdienstleistungen werden entweder durch gemeinsame Einrichtungen aus Bundesagentur für Arbeit und Kommunen oder in alleiniger Verantwortung von Kommunen bereitgestellt.
Je nach Größe der Bedarfsgemeinschaft erhalten die Hilfebedürftigen neben den Kosten der Unterkunft eine pauschalierte Regelleistung, die sich am soziokulturellen Existenzminimum orientiert. Mögliches Erwerbseinkommen wird auf die Regelleistung angerechnet. 100 Euro sind dabei komplett freigestellt. Ein darüber hinausgehendes Erwerbseinkommen wird mit 80 % bis 90 % angerechnet, das heißt, es verbleiben lediglich 10 % bis 20 % des Hinzuverdienstes bei den Hartz-IV-Beziehenden. Mangelnde Mitwirkung seitens der Hilfebedürftigen wird als Meldeversäumnis oder Pflichtverletzung in Form einer Leistungskürzung sanktioniert.
Die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen entsprechen weitgehend den herkömmlichen Instrumenten der Arbeitslosenversicherung. Dazu kommen im SGB II öffentlich geförderte Formen der Beschäftigung (wie z.B. Ein-Euro-Jobs), die Maßnahmen des noch relativ jungen Programms „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ , sozialintegrative Leistungen (wie z.B. die Schuldnerberatung) sowie die Förderung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche.
In der Abbildung 2 wird die Entwicklung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden und ihr Anteil an der Wohnbevölkerung der Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen und der jeweiligen Arbeitslosenquoten gegenübergestellt.
Zu den erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden zählen neben den Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II, erwerbstätige Hilfebedürftige, Maßnahmeteilnehmer-/innen, die sich gerade in einer Qualifizierungsmaßnahme o.Ä. befinden, und Personen, die z.B. aufgrund von Betreuungspflichten nicht zur Arbeitsuche verpflichtet sind.
Die Abbildung verdeutlicht, dass im Vergleich mit der Arbeitslosigkeit die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden weniger stark auf die Konjunktur reagiert. Im Aufschwung zwischen Finanz- und Corona-Krise war der Rückgang der Leistungsbeziehenden schwächer, während der Corona-Krise fiel dann aber auch der Anstieg geringer aus.
Im Zuge des Rückgangs der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden ging auch die Zahl der erwerbstätigen Hilfebedürftigen („Aufstocker“) und die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden zurück (Lietzmann/Wenzig, 2021; Walwei, 2022). Dagegen ist der Anteil der Langzeitleistungsbeziehenden an allen Leistungsempfängern mit rund zwei Drittel auf einem sehr hohen Niveau verblieben (Walwei, 2019).
Vertiefte Analysen zeigen, dass ein Großteil der erwerbsfähigen Leistungsbezieher nur vergleichsweise geringe Beschäftigungschancen hat (siehe Abbildung 3): Rund 50 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden hatte Mitte der 10er Jahre eine Beschäftigungswahrscheinlichkeit von nicht mehr als 20 %.
Hintergrund hierfür ist, dass viele Personen sog. multiple Risiken aufweisen. Ihnen kann es beispielsweise gleichzeitig an Bildung und Ausbildung fehlen, sie weisen evtl. gesundheitliche Beeinträchtigungen auf oder die Sprachkenntnisse reichen nicht aus (Beste/Trappmann, 2016).
Aufgrund der durch die wirtschaftliche Transformation wahrscheinlich steigenden Qualifikationsanforderungen besteht darüber hinaus das Risiko, dass sich Leistungsbezug und Arbeitslosigkeit nach der Corona-Krise ohne zusätzliche Bildungsanstrengungen weiter verfestigen (Weber, 2021)
Handlungsfelder und Handlungsoptionen

Zu den verschiedenen Reformansätzen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende liegen eine Vielzahl von Wirkungsbefunden vor, die bei der Frage nach der Reichweite möglicher Anpassungen weiterhelfen können.
Zunächst einmal ist zum Gesamteffekt der Hartz IV-Reform festzuhalten, dass diese einen spürbaren Beitrag zu dem nach 2005 einsetzenden Arbeitsmarktaufschwung geleistet haben dürfte (Klinger et al., 2013; Hochmuth et al., 2019; Hutter et al., 2019). Die positiven Effekte stehen im Zusammenhang mit einer höheren Suchintensität auf Seiten der Bewerber/-innen, mehr Zugeständnissen bei der Arbeitsplatzsuche, einer gestiegenen Einstellungsbereitschaft der Betriebe und einer insgesamt verbesserten Passung von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage.
Makroökonomische Analysen liefern zudem unübersehbare Hinweise auf einen Abbau der sog. „strukturellen Arbeitslosigkeit“. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass von einem nicht unbeträchtlichen Risiko für den Arbeitsmarkt auszugehen wäre, wenn man das Gesamtsystem über Bord werfen würde.
Wenn also ein Systemwechsel nicht wirklich zu begründen ist, sollen im Folgenden einzelne Kritikpunkte und daraus resultierende Ableitungen in den Fokus genommen werden.
Die Ergebnisse zu den möglichen Effekten von Hartz IV auf soziale Ungleichheitensind komplex. Die relative Bedeutung der Niedriglohnbeschäftigung ist vor der Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende stärker gestiegen als danach (Kalina/Weinkopf, 2016; Hutter/Weber, 2017). Die sog. „Normalarbeitsverhältnisse“, also unbefristete und gleichermaßen vollzeitnahe Beschäftigung, verloren ebenfalls vor 2005 mehr an Bedeutung als danach (Sperber/Walwei, 2015). Durch diese Befunde kann aber nicht belegt werden, dass sich die Ungleichheiten ohne die Sozialreform nicht doch zurückgebildet hätten.
Wirkungsanalysen zeigen, dass der längere Bezug höherer Leistungen tendenziell auch die Arbeitslosigkeit verlängert, obwohl die längere Suche zu einem besseren „Match“ führen kann (Schmieder et al., 2016). Eine Orientierung des Leistungsbezugs am soziokulturellen Existenzminimum ist aber geboten, weil er mit Einschränkungen der materiellen Lebensbedingungen, sog. „Deprivation“, einhergehen kann (Christoph et al., 2016).
Menschen können sich aus finanziellen Gründen bestimmte Güter oder Dienste nicht leisten, was aufgrund der vorliegenden Befunde vor allem die kulturelle Teilhabe betrifft. Zu beachten ist zudem, dass empirische Analysen darauf hindeuten, dass rund 40 % der anspruchsberechtigten Personen keine Grundsicherung beziehen (Bruckmeier et al., 2013). Ein wichtiger Grund hierfür ist, dass die realisierbaren Ansprüche, wie z.B. bei erwerbstätigen Leistungsbeziehenden („Aufstocker“), oft zu gering ausfallen. Mit Blick auf die soziale Integration weisen (Langzeit-)Arbeitslose das geringste (soziale) Teilhabeempfinden auf (Gundert/Hohendanner, 2014). Beschäftigte empfinden eine im Allgemeinen höhere Teilhabe als Arbeitslose und dies unabhängig von der jeweiligen Erwerbsform (Abbildung 6).
Die Forschung liefert auch Befunde zur Verteilungssituation vor und nach der Hartz-IV-Reform.
Die „Armutsrisikoquote“ ist nach den Hartz-Reformen nicht signifikant gestiegen (Schupp et al., 2019). Zudem hat auch die faktische Abstiegswahrscheinlichkeit aus der mittleren Mittelschicht (zweites Einkommensquintil) nach den Reformen nicht zugenommen. Dagegen ist die Aufstiegswahrscheinlichkeit in den beiden unteren Einkommensquintilen gesunken, was auf eine mangelnde Aufwärtsmobilität hindeutet.
Um Abstiegsängsten der Mittelschicht entgegenzuwirken und Lebensleistungen besser zu honorieren, wird oft eine bessere Absicherung langjährig Berufstätiger gefordert. Denkbar wären etwa eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengelds vor Eintritt in die Grundsicherung oder höhere Leistungen für Personen mit längeren Beschäftigungszeiten nach Eintritt in dieGrundsicherung.
Der Umsetzung stehen aber Gleichbehandlungsprobleme entgegen. Langjährig Berufstätige sind materiell oft besser abgesichert und durch Berufserfahrung auch wettbewerbsfähiger als weniger stabil Beschäftigte. Besserstellungen können zwar längere Erwerbsbiografien begünstigen, tragen aber das Risiko geringerer Suchintensität und niedrigerer Konzessionsbereitschaft der Betroffenen nach Eintritt der Arbeitslosigkeit.
Eine alternative Option ist die Anpassung der bestehenden Regelungen zum Schonvermögen und zur Angemessenheit der Wohnung. So könnte man – wie jetzt auch im Koalitionsvertrag vorgesehen – an einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung denken. In Frage kommen dabei Übergangszeiten, in denen weder ein etwas höheres Vermögen noch der aktuelle Wohnraum angetastet wird. Dies trägt dem Grundgedanken Rechnung, dass neuzugegangene Personen anfangs mit weniger Druck auf die Arbeitsuche gehen können.

Die Wirkungen von Sanktionen auf die Leistungsbeziehenden sind ambivalent (Wolff, 2019; Wolf, 2021). Das Grundprinzip von Hartz IV, nämlich ein Fordern mit Augenmaß und die berechtigte Erwartung an die Leistungsberechtigten, bei der Überwindung ihrer Hilfebedürftigkeit mitzuwirken, hat sich bewährt.
Sanktionen beschleunigen die Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Sie verringern aber gleichzeitig die Qualität der auf genommenen Beschäftigung, verstärken den Rückzug aus dem Leistungsbezug und können die materielle und immaterielle Lebenssituation der Betroffenen stark beeinträchtigen.
Hieraus folgt ein Zielkonflikt, nämlich durch Sanktionen Arbeitsund Bildungsanreize aufrechtzuerhalten, ohne dabei eine gravierende Beeinträchtigung der Lebensbedingungen der Sanktionierten in Kauf zu nehmen.
Dies wäre auch ganz auf der Linie der Umsetzung des dazu erlassenen Urteils des Bundesverfassungsgerichts, das im November 2019 Sanktionen zur Durchsetzung der Mitwirkungspflichten für teilweise verfassungswidrig erklärt hat. Denn weitreichende Sanktionen und damit verbundene soziale Notlagen können das Ziel der gewünschten Mitwirkung der Leistungsbeziehenden beeinträchtigen.
Eine Sanktionsfreiheit ist aber ebenso problematisch, weil der Kontakt zu den wirklich Unterstützungsbedürftigen abreißen kann, es zu einer Übernutzung der Sozialsysteme und damit erheblicher finanzieller Lasten kommen kann und der Staat zunehmend als „uneingeschränkter Kümmerer“ wahrgenommen werden könnte.
Evaluationsstudien zeigen, dass die im Bereich der Grundsicherung eingesetzten Fördermaßnahmen ähnlich positive Eingliederungseffekte erzielen wie in der Arbeitslosenversicherung. Insbesondere für Langzeitarbeitslose ergeben sich hierbei besonders günstige Wirkungen (Bähr et al., 2018).
Generell weisen betriebsnahe Maßnahmen die stärksten Positiveffekte auf. Allerdings birgt eine Fokussierung auf eine schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt die Gefahr, dass eher Jobs mit geringen Verdienstchancen und hohem Entlassungsrisiko angenommen werden müssen, was in manchen Fällen einer nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt im Wege steht.
In vielen Fällen ist eine Weiterbildung und die Förderung der persönlichen Entwicklung durch sozialpädagogische Betreuung nachhaltiger als die schnelle Vermittlung. Von Bedeutung ist dabei, dass wissenschaftlichen Befunden zufolge ein enger Betreuungsschlüssel in einem positiven Zusammenhang zum Eingliederungserfolg steht.
Administrative Vereinfachungen im Leistungsbezug, wie beispielsweise Pauschalierungen oder Bagatellgrenzen, würden Personalressourcen für eine aktive Wiedereingliederungspolitik freimachen.
Als am wenigsten erfolgreich erwiesen sich bis dato beschäftigungsschaffenden Maßnahmen, wie z.B. Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs etc.). Bei undifferenzierter Förderung besteht hier vor allem das Risiko von Einsperrund Verdrängungseffekten, das heißt, dass Geförderte zu lange in solchen Jobs verharren (lock-in-Effekt) bzw. reguläre Jobs verdrängt werden.
Mit dem sog. „sozialen Arbeitsmarkt“ sind seit dem 1.1.2019 neue Instrumente auf den Weg gebracht worden, die stärker auf Teilhabe arbeitsmarktferner Gruppen zielen. Die ersten Erkenntnisse zeigen, dass die Zielgruppe erreicht wird und erwartet werden darf, dass sich – wie bei Vorläuferinstrumenten – das Teilhabeempfinden der Geförderten verbessert und deren soziale Stabilisierung begünstigt wird (Bauer et al., 2021).
Schließlich muss die Anrechnung von Erwerbseinkommen auf das Arbeitslosengeld II als ein weiteres Handlungsfeld charakterisiert werden und dies aus zwei Gründen: Zum einen setzen die Regeln zwar vergleichsweise hohe Anreize, in den Arbeitsmarkt einzutreten, aber nur geringe Anreize zur Ausweitung des Arbeitseinkommens. Dazu kommt ein suboptimales Zusammenspiel von Grundsicherung, Wohngeld und Kindergeldzuschlag.
In bestimmten Fallkonstellationen bleibt daher für Hilfeempfängerinnen und -empfänger nur wenig oder gar nichts von Verdienstzuwächsen, wodurch die Arbeitsanreize für den davon betroffenen Personenkreis besonders gering ausfallen. (Bruckmeier et. al., 2018).
Die Vorschläge zu einer großzügigeren Anrechnung von Erwerbseinkommen auf die Grundsicherung reichen von niedrigeren Transferentzugsraten bis hin zu einer weitreichenden Neuordnung des Niedrigeinkommensbereichs, bei der das Wohngeld, Kindergeld und Kindergeldzuschüsse, Sozialversicherungsregelungen und steuerrechtliche Bestimmungen zu berücksichtigen wären.
Das Ziel einer großzügigeren Anrechnung würde vor allem darin bestehen, nicht nur eine schnelle Wiedereingliederung, sondern auch und gerade eine möglichst nachhaltige Beendigung der Hilfebedürftigkeit zu erreichen. Hierzu könnten die Anrechnungsregelungen gelockert werden, sodass den Hilfeempfängerinnen und -empfängern im Falle einer Beschäftigung mehr vom Verdienst verbleibt.
Zielführend sind gezielte Zuschüsse im Falle der Aufnahme einer Vollzeitbeschäftigung. Bisher wirken die Arbeitsanreize eher bei Beschäftigungsverhältnissen im Teilzeitbereich – und hier am stärksten bei Minijobs, die keine umfassende Integration in den Arbeitsmarkt mit sich bringen. Als politische Nebenwirkung müsste allerdings eine höhere Zahl der erwerbsfähigen Leistungsempfänger in Kauf genommen werden.
Solche Reformen müssen aber auch die damit verbundenen fiskalischen Kosten ins Blickfeld nehmen. Ein vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ins Spiel gebrachter Erwerbszuschuss, der in Verbindung mit verbesserten Anrechnungsregelungen Wohngeld und Kindergeldzuschlag obsolet machen würde, wäre zwar nicht ganz aufkommensneutral, seine Kosten lägen aber mit 2 bis 3 Mrd. Euro noch einigermaßen im Rahmen (ebd.).
Durch den Erwerbszuschuss würden nicht nur die Arbeitsanreize gestärkt, sondern auch die Nettoeinkommensposition vieler Niedrigeinkommenshaushalte verbessert. Einen kostenneutralen Vorschlag mit einer ähnlichen Stoßrichtung legte auch das IfoInstitut vor (Blömer et al., 2019).
Hartz IV: Fazit und Ausblick

Der Beitrag hat gezeigt, dass es in der Grundsicherung unabweisbare Entwicklungsbedarfe gibt. Diese begründen aber nach den Wirkungsbefunden keinen Neustart.
Das SGB II steht vor der immer wieder herausfordernden Aufgabe, einerseits die sozialen Lebensbedingungen für Menschen in finanzieller Notsituation in sozial angemessener Weise auszugestalten und andererseits wirksame Rahmenbedingungen für eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu schaffen.
Ein zumindest befristet großzügigeres Schonvermögen, mehr Transfers an Erwerbstätige, eine erleichterte Administration des Leistungsbezugs, eine bessere soziale Grundversorgung für alle Bürger im unteren Einkommensbereich, die Abschaffung von „Totalsanktionen“ und der kluge Aufbau eines sozialen Arbeitsmarktes würden dazu beitragen, die in der Summe positiven Wirkungen der Grundsicherung am Arbeitsmarkt aufrechtzuerhalten und einen wirksamen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft zu leisten.
Wenn sich die Debatte über das Für und Wider von Hartz IV zu sehr polarisiert, vergibt man die Chance, die Grundsicherung dort zu stärken, wo sie Stärkung braucht: bei der Beschäftigungsförderung. Daher wäre es anzuraten, die knappen Mittel im SGB II eher für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsmarktintegration der Leistungsbeziehenden einzusetzen als für eine starke Erhöhung der Regelsätze.
Mindestens ebenso sehr wird es aber in der absehbaren Zukunft darauf ankommen, die Anstrengungen zur Prävention zu intensivieren und damit den Nachschub an Personen mit geringer Beschäftigungsfähigkeit zu begrenzen.
Ansatzpunkte hierfür sind Bildung, Aus- und Weiterbildung auf der einen sowie gesundheitliche Vorsorge auf der anderen Seite.
Mögliche Folgeprobleme am Arbeitsmarkt könnten durch die Vermeidung von Bildungsarmut möglichst schon im frühkindlichen Bereich vermieden werden. Körperlich und mental stark belastende Tätigkeiten dürfen angesichts einer stetigen Verlängerung des Erwerbslebens nicht zu lange ausgeübt und akzeptable Alternativen müssen dazu gefunden werden.
Literaturhinweise
Literaturhinweise
Bähr, Holger/Dietz, Martin/ Kupka, Peter/ Ramos Lobato, Philipp/ Stobbe, Holk (2018): Grundsicherung und Arbeitsmarkt in Deutschland: Lebenslagen - Instrumente - Wirkungen. (IABBibliothek, 370), Bielefeld: Bertelsmann, 394 S.
Bauer, Frank/Bennett, Jenny/Dietz, Martin/ Fuchs, Philipp/ Gellermann, Jan/ Globisch, Claudia/Gottwald, Markus/ Kupka, Peter/ Nivorzhkin, Anton/ Promberger, Markus/ Ramos Lobato, Philipp/Wolff, Joachim/Zabel, Cordula/Zins, Stefan (2021): Evaluation der Förderinstrumente nach § 16e und § 16i SGB II – Zwischenbericht. (IABForschungsbericht, 03/2021), Nürnberg, 197 S.
Beste, Jonas/Trappmann, Mark (2016): Erwerbsbedingte Abgänge aus der Grundsicherung: Der Abbau von Hemmnissen macht‘s möglich. (IABKurzbericht, 21/2016), Nürnberg, 8 S.
Blömer, Maximilian/Fuest, Clemens/ Peichl, Andreas (2019): Raus aus der Niedrigeinkommensfalle(!) Der ifoVorschlag zur Reform des Grundsicherungssystems. In: ifo Schnelldienst, Jg. 72, H. 4, S. 34-43.
Bruckmeier, Kerstin/Pauser, Johannes/Riphahn, Regina T./Walwei, Ulrich (2013): Mikroanalytische Untersuchung zur Abgrenzung und Struktur von Referenzgruppen für die Ermittlung von Regelbedarfen auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2008. Simulationsrechnungen für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Endbericht, 17. Juni 2013. Gutachten. Nürnberg, 247 S. Bruckmeier, Kerstin/Mühlhan, Jannek/Peichl, Andreas (2018): Mehr Arbeitsanreize für einkommensschwache Familien schaffen. In: Ifo-Schnelldienst, Jg. 71, H. 3, S. 25-28.
Christoph, Bernhard/Lietzmann, Torsten/Tophoven, Silke/ Wenzig, Claudia (2016): Materielle Lebensbedingungen von SGB-II-Leistungsempfängern. (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Berichte, 21/2016), Nürnberg, 8 S.
Gundert, Stefanie/Hohendanner, Christian (2014): Soziale Integration von befristet Beschäftigten und Leiharbeitern in Deutschland. In: Arbeit. Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik, Jg. 23, H. 3, S. 256-271.
Hochmuth, Brigitte/Kohlbrecher, Britta/Merkl, Christian/Gartner, Hermann (2019): Hartz IV and the Decline of German Unemployment: A Macroeconomic Evaluation. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Institute for Employment Research, Nürnberg, 41 S.
Hutter, Christian/Weber, Enzo (2017): Labour market effects of wage inequality and skill-biased technical change in Germany. (IAB-Discussion Paper, 05/2017), Nürnberg, 31 S.
Hutter, Christian/Klinger, Sabine/ Trenkler, Carsten/Weber, Enzo (2019): Which factors are behind Germany’s labour market upswing (IAB-Discussion, 20/2019), Nürnberg, 54 S.
Kalina, Thorsten/Weinkopf, Claudia (2020): Niedriglohnbeschäftigung 2018 – Erstmals Rückgang, aber nicht für Geringqualifizierte und Minijobber*innen. In: IAQ-Report, Nr. 5, 23 S.
Klinger, Sabine/Rothe, Thomas/Weber, Enzo (2013): Makroökonomische Perspektive auf die Hartz-Reformen: Die Vorteile überwiegen. (IAB-Kurzbericht, 11/2013), Nürnberg, 8 S.
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP) (2021): Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Abgerufen am 07.12.2021 unter www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800 (11.02.2022).
Lietzmann, Torsten/Kupka, Peter/Ramos Lobato, Philipp/Trappmann, Mark/Wolf, Joachim (2018): Sozialer Arbeitsmarkt für Langzeiterwerbslose: Wer für eine Förderung infrage kommt. (IAB-Kurzbericht, 20/2018), Nürnberg, 12 S.
Lietzmann, Torsten/Wenzig, Claudia (2021): Erwerbstätigkeit und Grundsicherungsbezug: Wer sind die Aufstocker:innen und wie gelingt der Ausstieg. Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh, 93 S.
Schmieder, Johannes/von Wachter, Till/Bender, Stefan (2016): The causal effect of unemployment duration on wages: Evidence from unemployment insurance extensions, American Economic Review 106, 739–777.
Schupp, Jürgen/Becker, Gerhard/Walwei, Ulrich/Eichhorst, Werner/Rinne, Ulf/Blömer, Maximilian/Fuest, Clemens/Peichl, Andreas (2019): Hartz IV - Reform einer umstrittenen politischen Maßnahme. Zeitgespräch. In: Wirtschaftsdienst, Vol. 99, No. 4, S. 235-255.
Sperber, Carina/Walwei, Ulrich (2015): Trendwende am Arbeitsmarkt seit 2005: Jobboom mit Schattenseiten? In: WSI-Mitteilungen, Jg. 68, H. 8, S. 583- 592.
Walwei, Ulrich (2019): Hartz IV - Gesetz, Grundsätze, Wirkung, Reformvorschläge. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Vol. 69, Nr. 44/45, S. 12-21.
Walwei, Ulrich (2022): Aufstocker: Die Kerngruppe der Erwerbsarmut. In: Sozialer Fortschritt, im Erscheinen.
Weber, Enzo (2021): Qualifizierung: Weiterbildungskonzept für Krisen. In: Wirtschaftsdienst, Vol. 101, Nr. 3, S. 154.
Wolf, Markus (2021): Schneller ist nicht immer besser: Sanktionen können sich längerfristig auf die Beschäftigungsqualität auswirken (Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2017 bis 2020“). In: IAB-Forum, 24.06.2021, o. Sz.
Wolff, Joachim (2019): Das Solidarische Grundeinkommen wäre der falsche Weg (Serie „Zukunft der Grundsicherung“). In: IAB-Forum, 13.06.2019, o. Sz.
Autor: Prof. Dr. Ulrich Walwei. Der Beitrag ist unter dem Titel „Hartz IV – Zeit für Reformen“ in dem Heft „Arbeitsmärkte" der LpB-Zeitschriften-Reihe „Deutschland&Europa" erschienen.
Stand: Mai 2022.
Unterrichtsmaterial: Das Bürgergeld
Unterrichtsmaterial „Das Bürgergeld - Eine Reform von Hartz IV oder der Systemwechsel bei der Grundsicherung?“ herunterladen (PDF-Downoad).
Aus der Zeitschrift „Arbeitsmärkte in Deutschland und Europa" (2022) der Reihe „Deutschland&Europa".