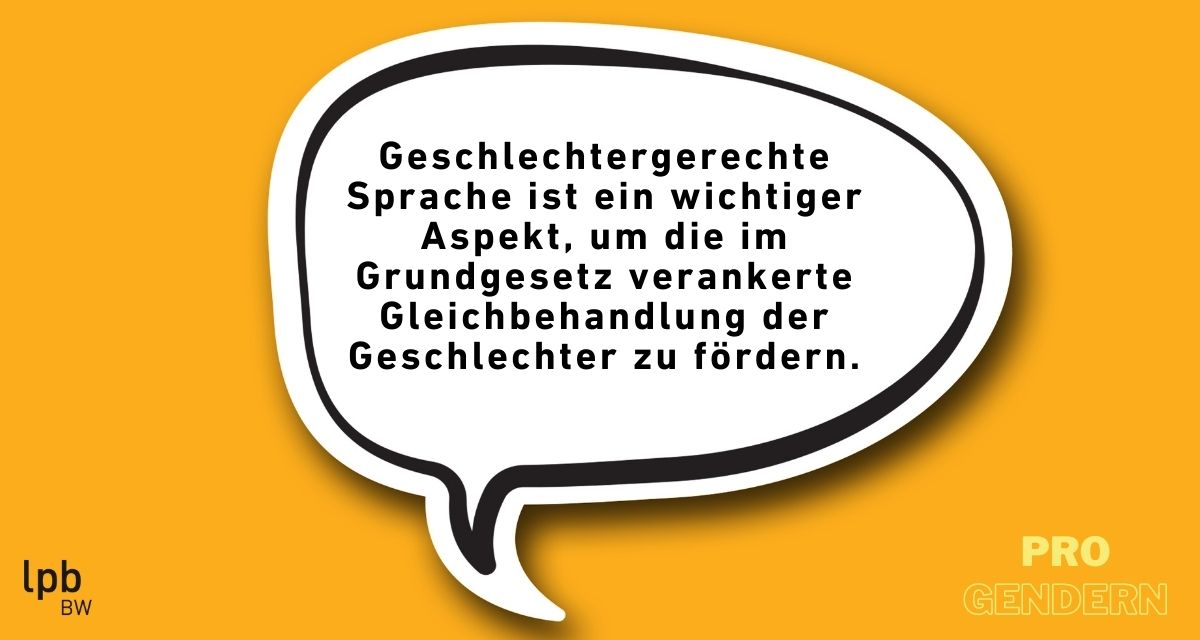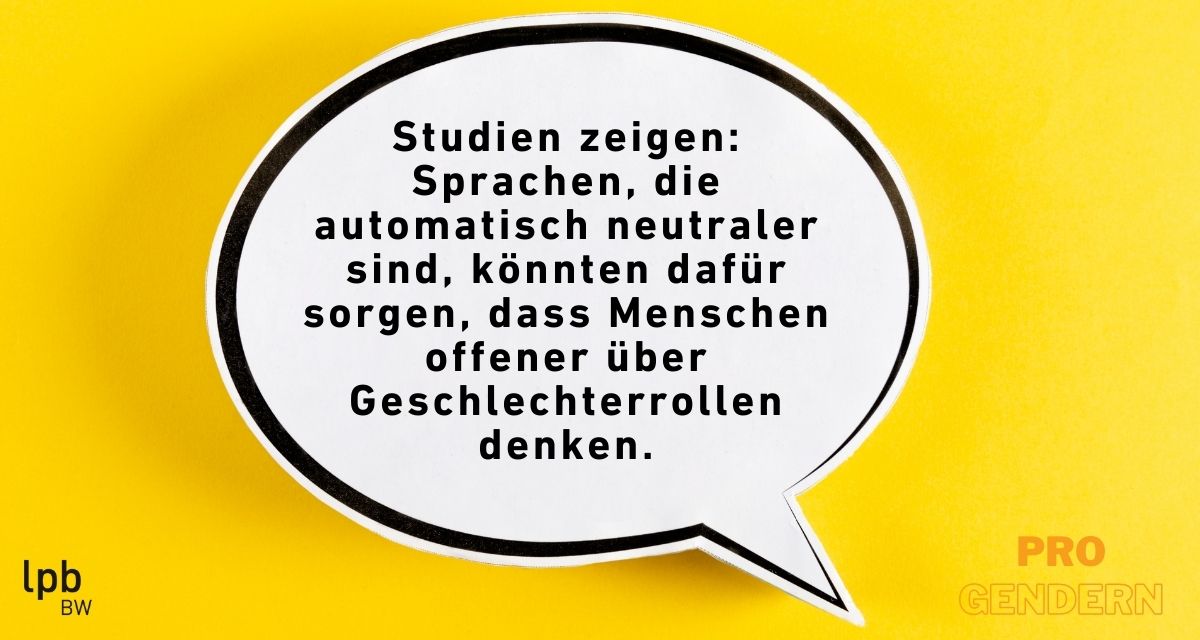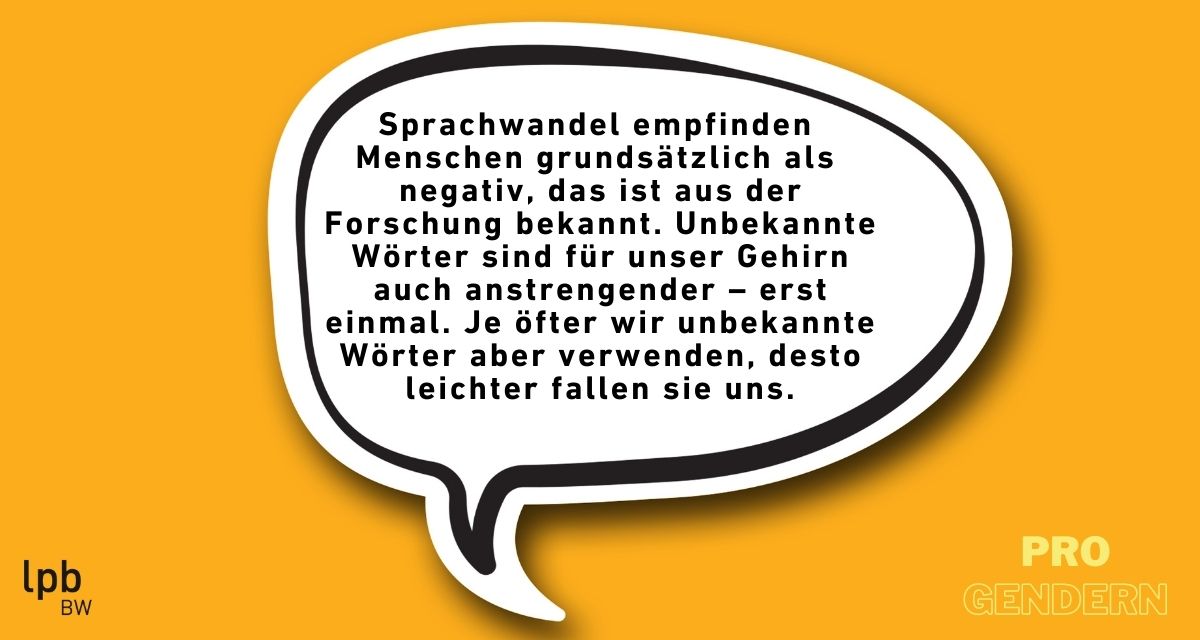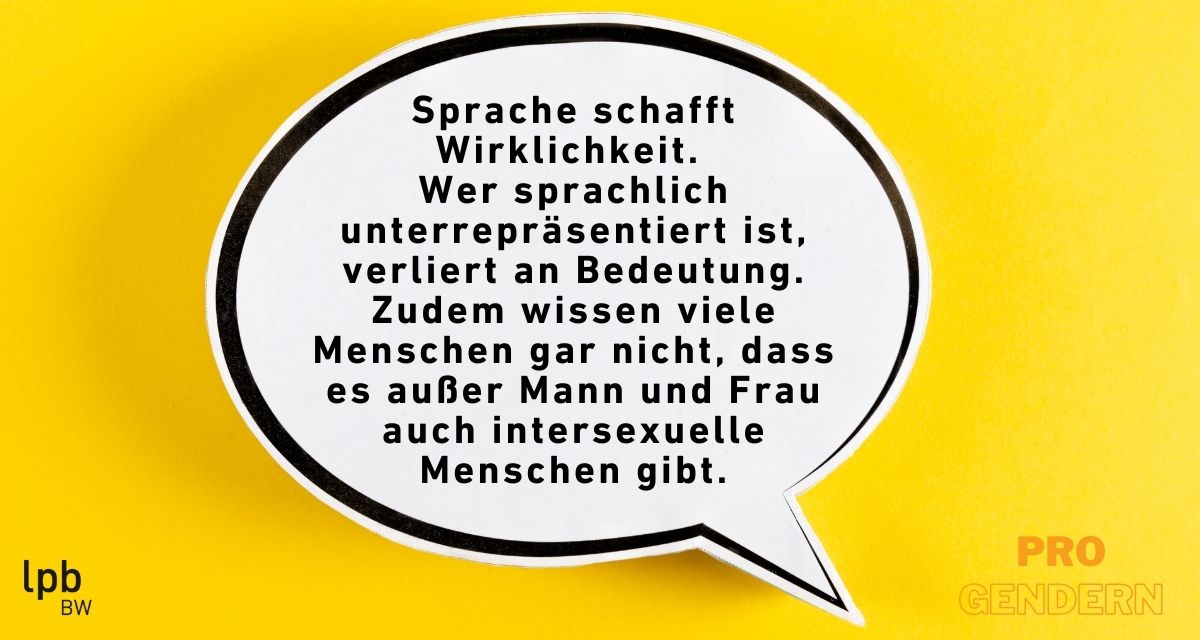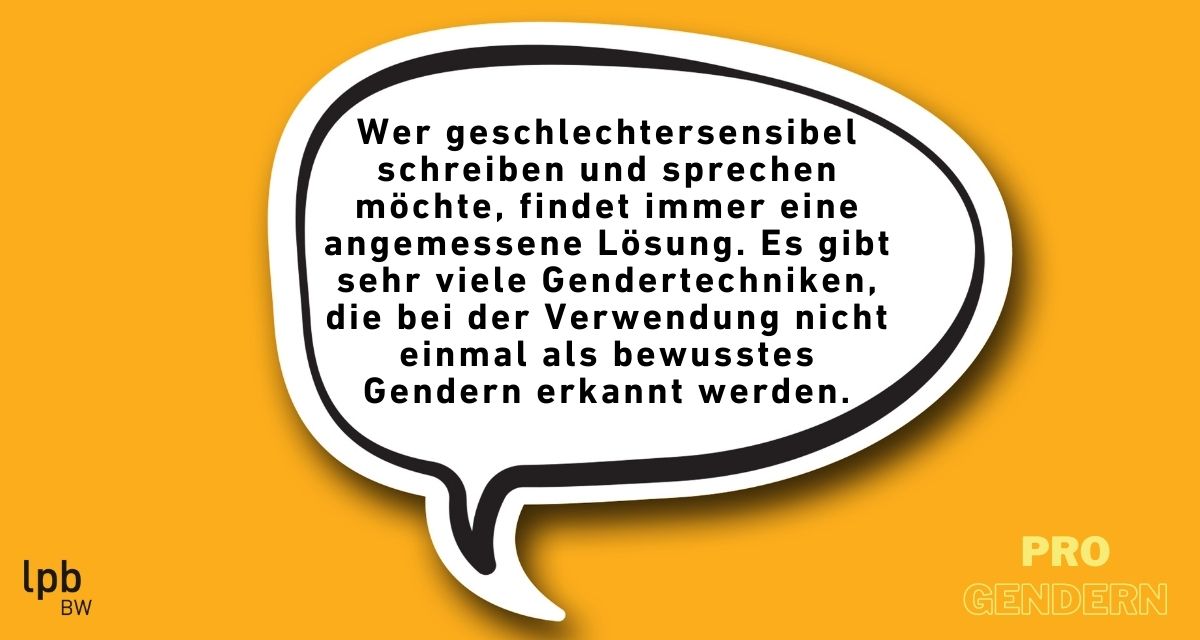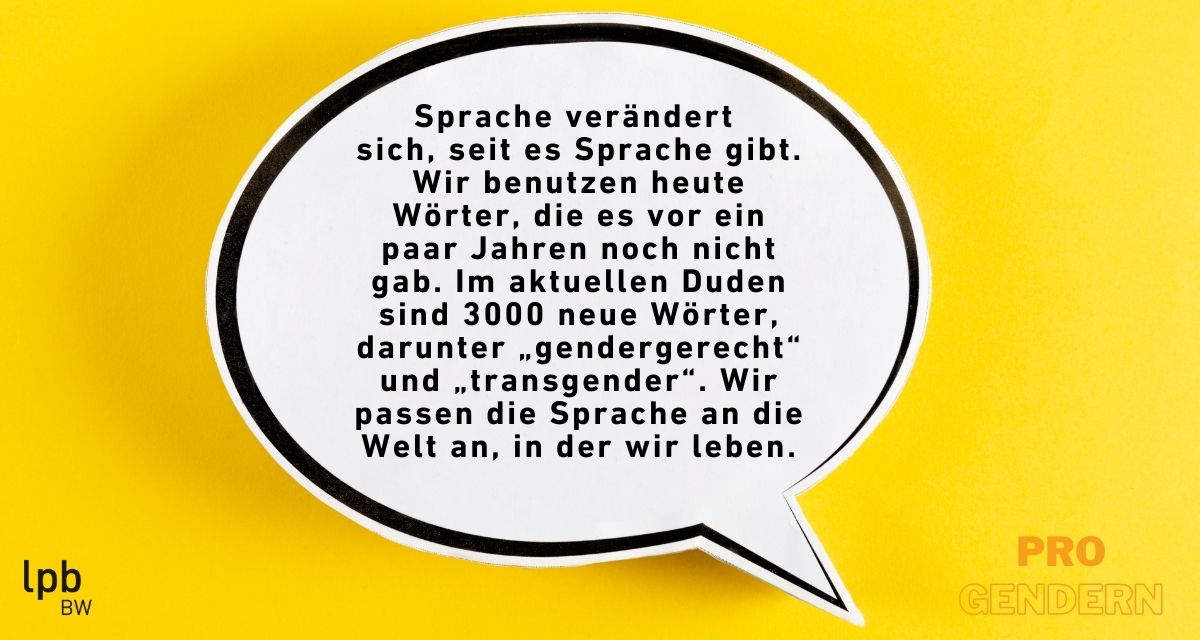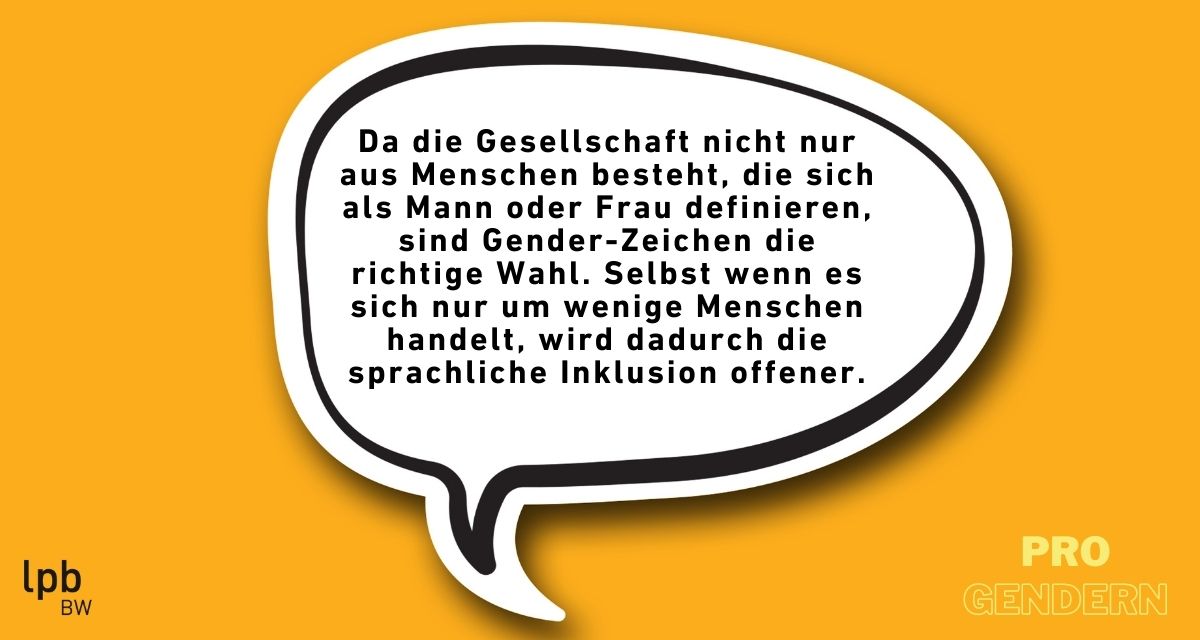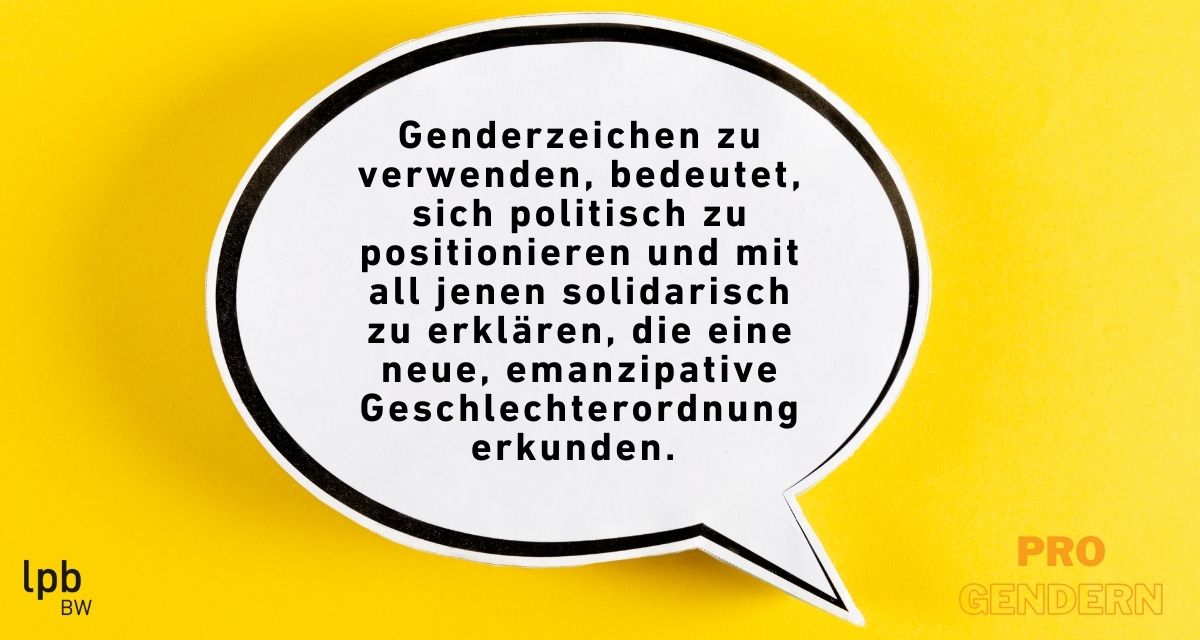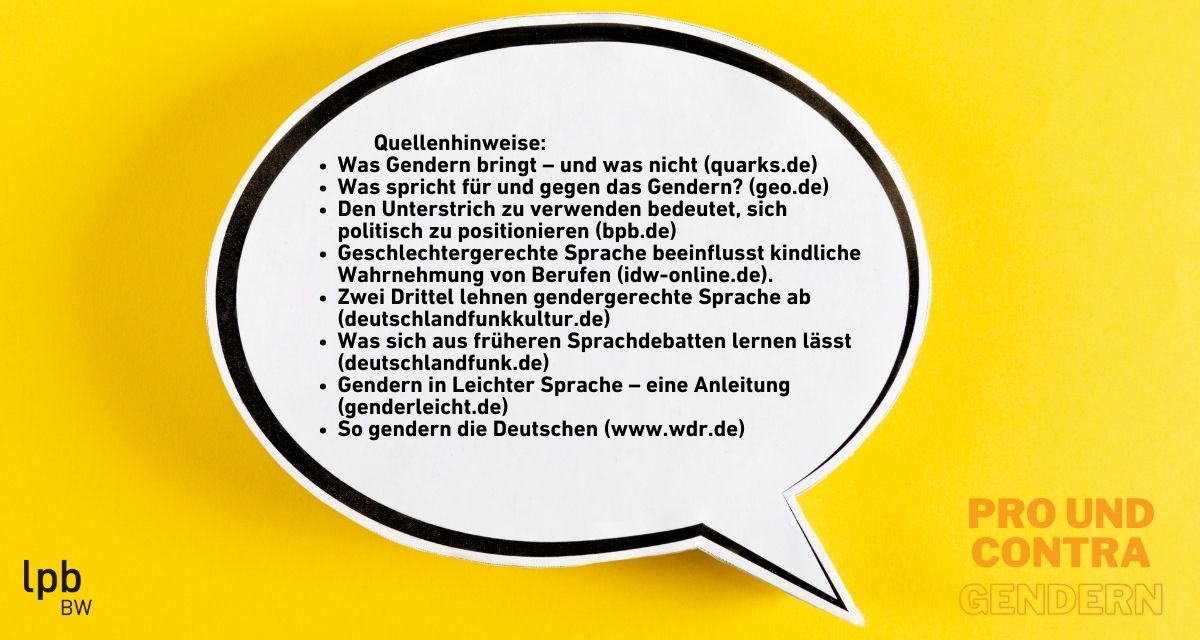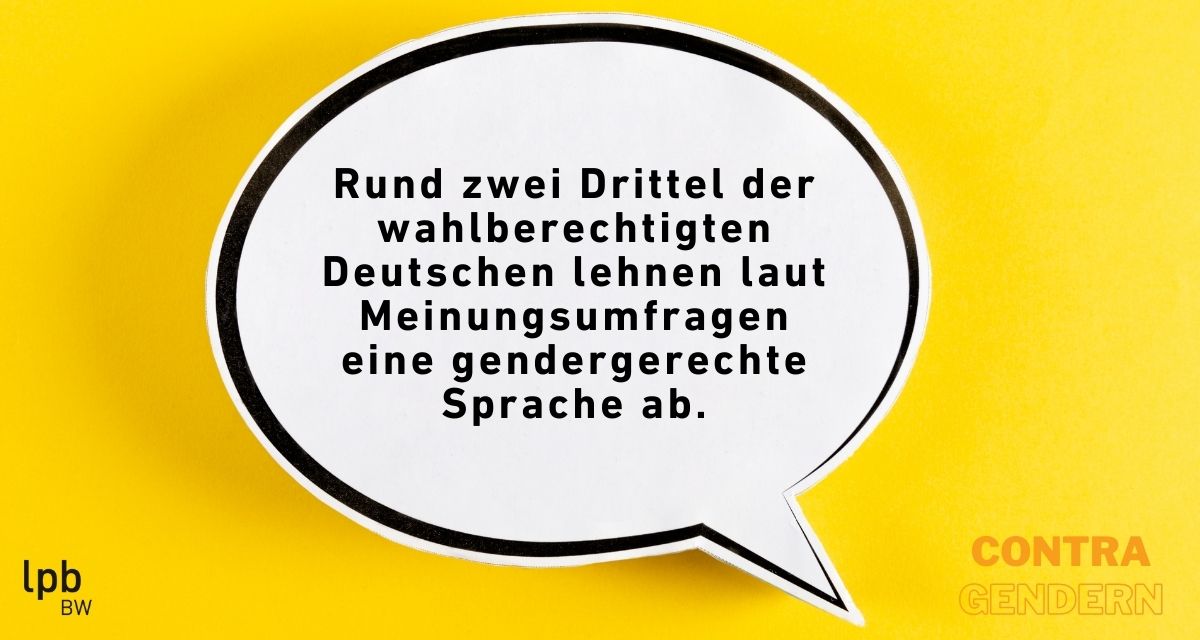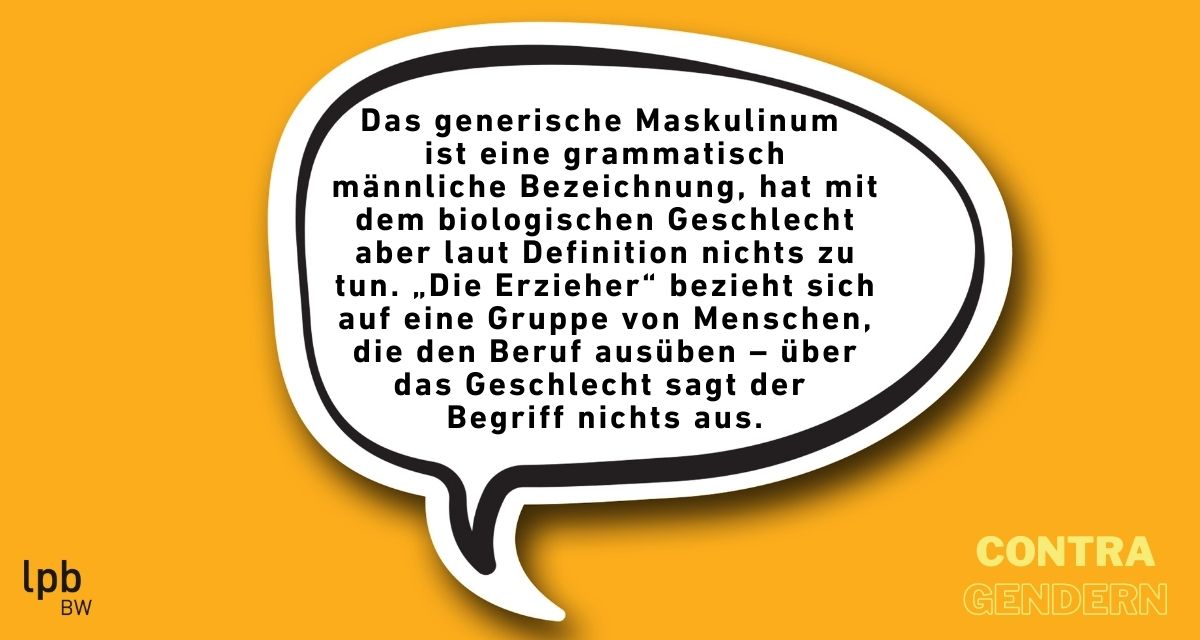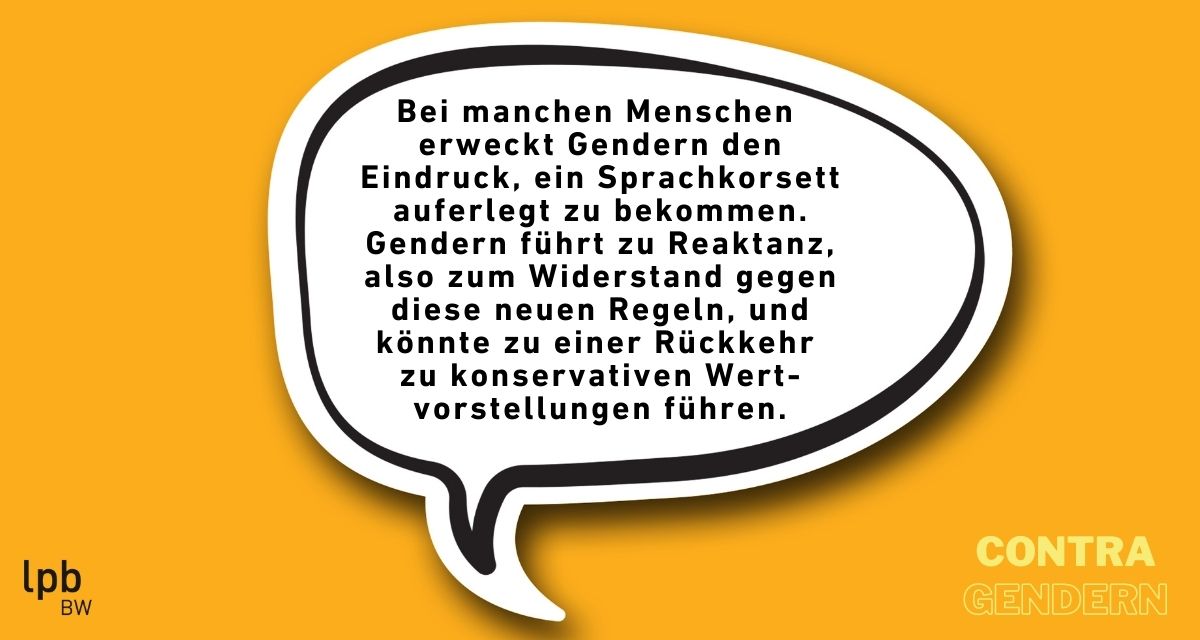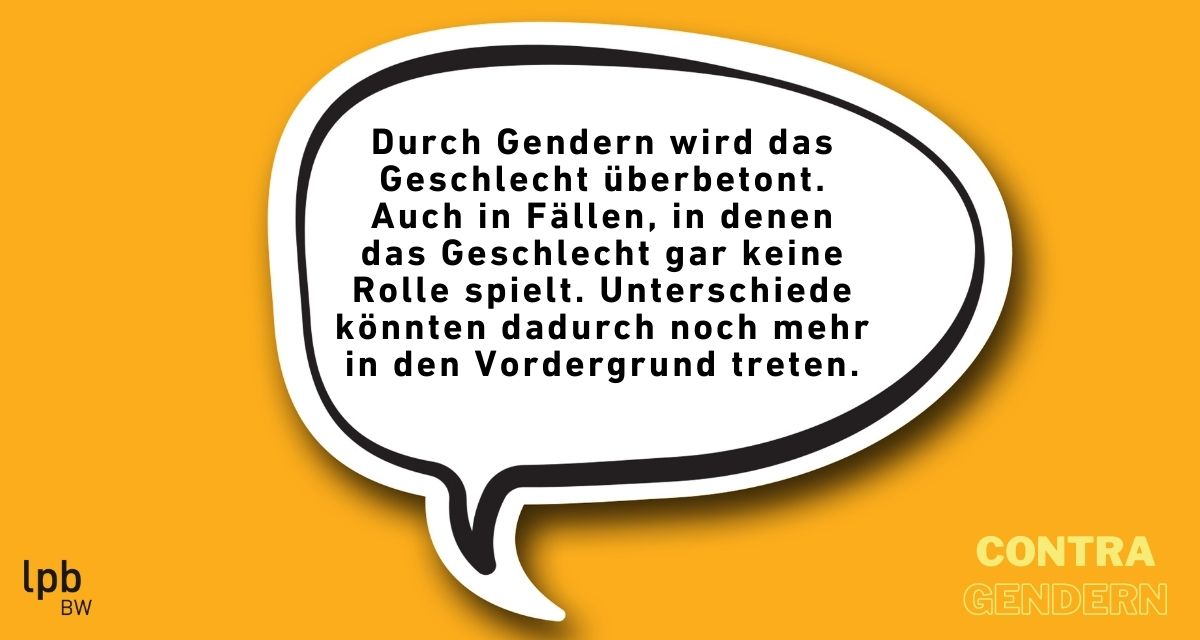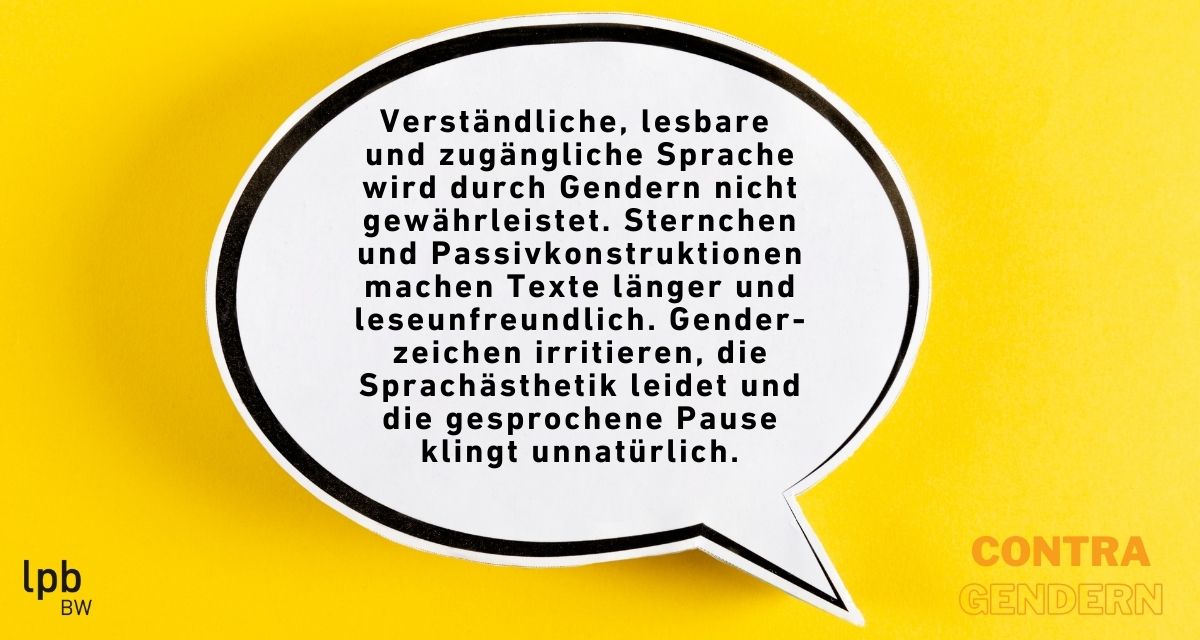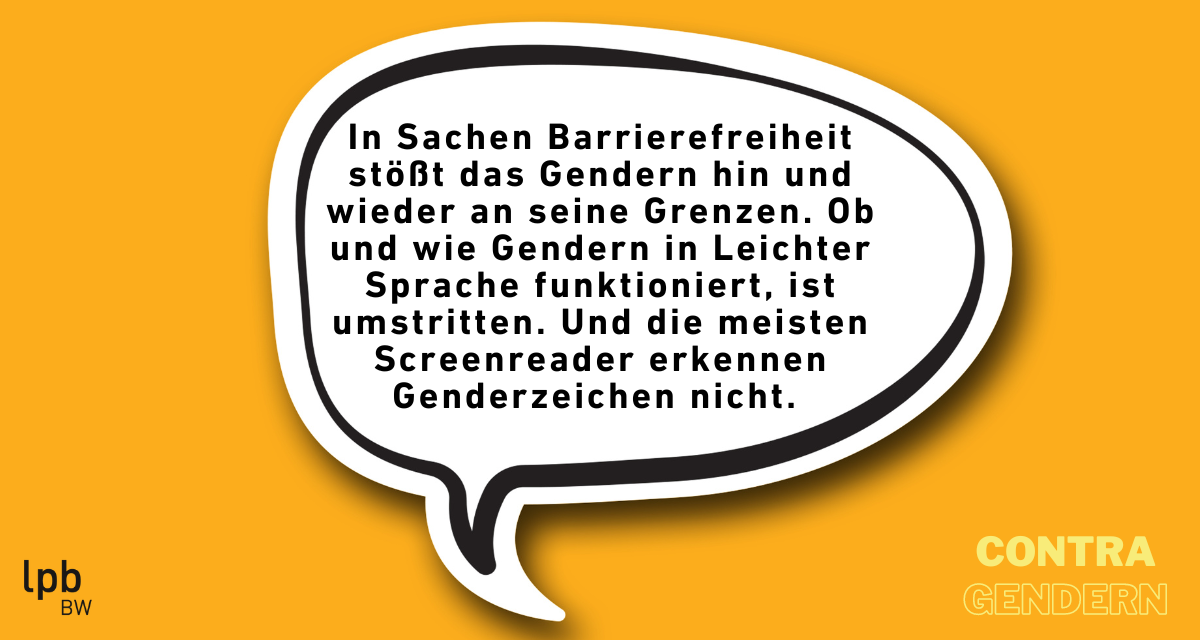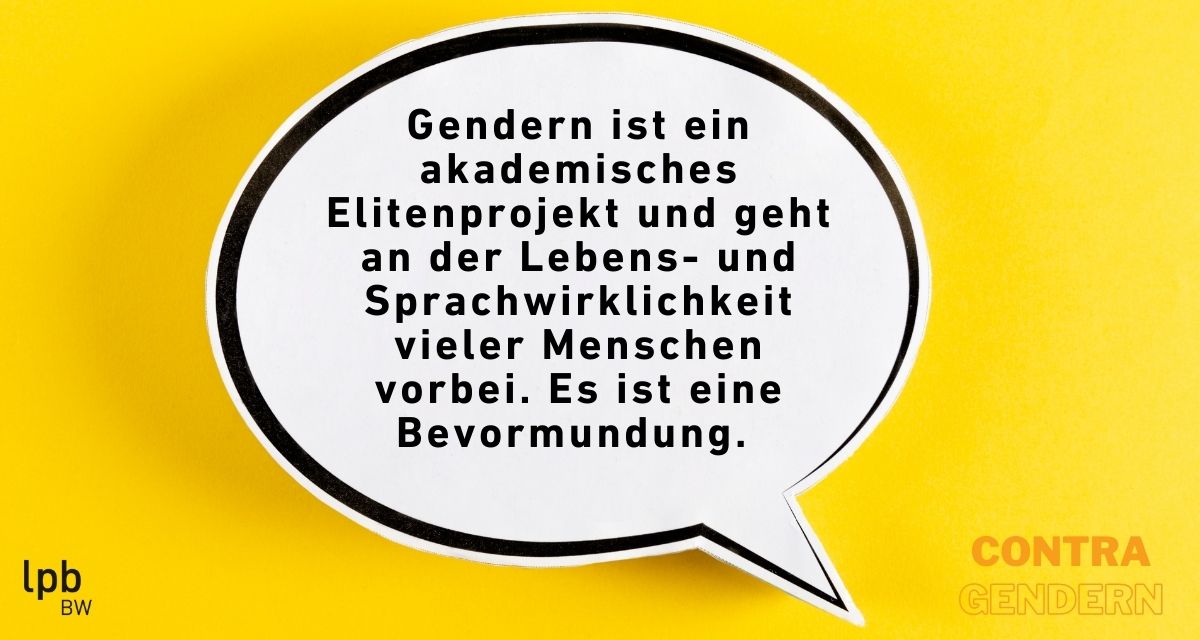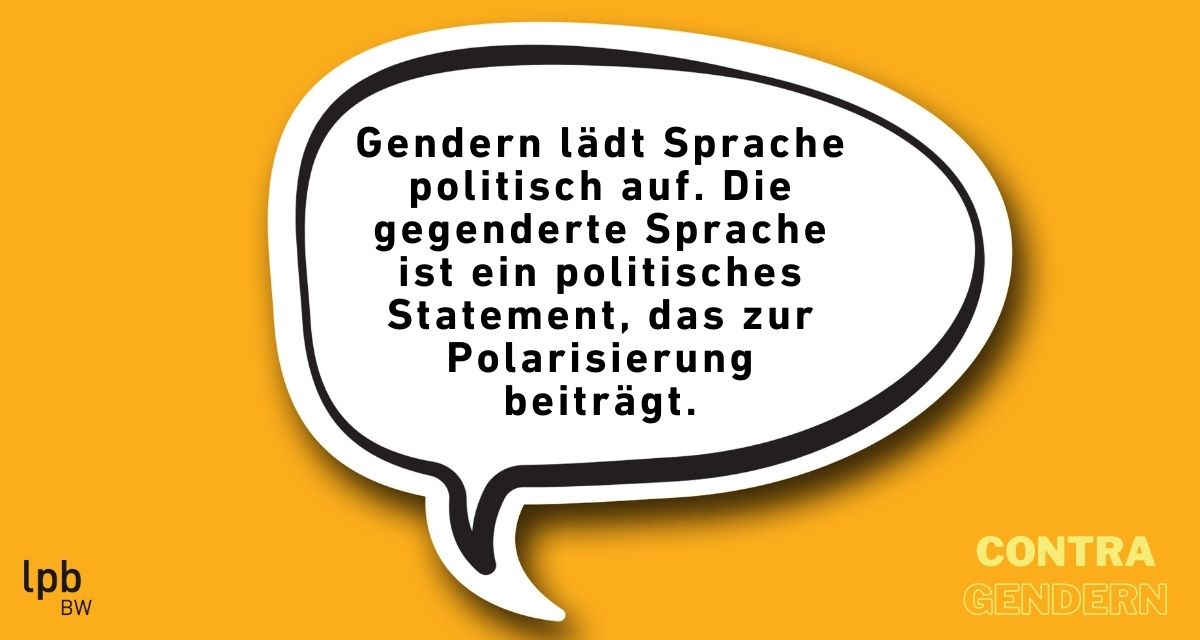Dossier
Gendern: Ein Pro und Contra
Was für die gendergerechte Sprache spricht – und was dagegen. Ein Pro und Contra

Über das Gendern ist eine heftige und emotionale Debatte entbrannt. Ob und in welcher Form Sprache geschlechtersensibel sein soll, darüber scheiden sich die Geister. Für die einen ist es Ausdruck der Gleichstellung, für die anderen ist es Bevormundung. Wir wollen in diesem Dossier einen Überblick geben: Was ist Gendern? Welche Formen der geschlechtergerechten Sprache gibt es? Warum ist die Sprachdebatte so hitzig? Und vor allem: Was spricht für das Gendern – und was dagegen?
Gendern: Was ist das?
Kurz & knapp

- Das Wort „gender“ kommt aus dem Englischen und bedeutet Geschlecht. Damit ist nicht das biologische Geschlecht, sondern das soziale Geschlecht gemeint.
- Ein soziales Geschlecht bezieht sich auf alles, was als typisch für Frauen und Männer gilt. Es geht um das gelebte und gefühlte Geschlecht, nicht um das aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesene Geschlecht.
- Gendern bedeutet geschlechtergerechte Sprache. Mit dem geschlechterbewussten Sprachgebrauch soll die Gleichbehandlung alle Geschlechter/Identitäten zum Ausdruck gebracht werden.
- Im Deutschen wird bis heute meist das generische Maskulinum verwendet, also die männliche Variante. Personen und Berufe werden grammatisch männlich bezeichnet, obwohl es in aller Regel auch eine weibliche Wortform gibt.
- Seit der rechtlichen Einführung der dritten Geschlechtsoption „divers“ im Jahr 2018 wird zudem über eine mehrgeschlechtliche Schreibweise diskutiert, die nicht nur das männliche und weibliche Geschlecht einschließt, sondern auch andere Geschlechtsidentitäten.
- Diskussionen über eine geschlechtergerechte deutsche Sprache gibt es seit den 1970er Jahren. Die Positionen sind oft verhärtet. Die einen sehen Gendern als Ausdruck der Gleichstellung, andere empfinden es als Sprachverhunzung und Bevormundung.
Welche Formen des Genderns gibt es?
(Quelle: Quarks.de)
- Beidnennung: Beide Geschlechter werden genannt (z. B. Lehrerinnen und Lehrer) oder die weibliche Form wird durch Abkürzung hinzugefügt (Lehrer/-innen; LehrerInnen).
- Neutralisierung: Die männliche Form wird durch geschlechterneutrale Formen (z. B. Lehrkraft) oder Substantivierung (z. B. Lehrende) ersetzt.
- Gender-Zeichen: Für die mehrgeschlechtliche Schreibweise wird zwischen männlicher Form und weiblicher Endung ein Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt ergänzt (z. B. Lehrer*innen, Lehrer_innen, Lehrer:innen). Die Sonderzeichen sind Platzhalter für alle, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen.
Wie gendere ich richtig? Welche Variante ist korrekt?
Geschlechtergerechte Sprache kommt sehr vielfältig daher. Welche Form des Genderns die optimale ist, dafür gibt es aus wissenschaftlicher Sicht noch kein abschließendes Votum. Die Meinungen gehen auseinander. Während die einen zu einer Mischform – zum Beispiel zum zielgruppenorientierten Einsatz der Genderformen – raten, sprechen sich andere für eine bestimmte Form des Genderns aus. Als „politisch korrekt“ hatte sich zunächst das Gendersternchen, der sogenannte Asterisk, etabliert. Inzwischen ist es oft auch der Doppelpunkt. Die Variante des Gendersternchens oder des Doppelpunkts spricht nicht nur Männer und Frauen an, sondern auch Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten. Die Selbstvertretung der LGBTQI verwendet meist entweder das Gendersternchen als LGBTQI* oder schreibt sich LGBTQI+ und umgeht damit die Verwendung eines Genderzeichens.
im Netz
Wo finde ich Tipps zum Gendern?
Wer gendern will, findet mittlerweile viele Tipps im Netz, zum Beispiel im Genderwörterbuch. Handreichungen zur gendersensiblen Sprache gibt es zahlreiche, siehe weitere Infos.
Kritik um Sonderzeichen
Die Auseinandersetzungen ums Gendern entzünden sich vor allem an den Sonderzeichen. Die Beidnennung oder die Umschreibung ist an vielen Stellen längst Alltag. Die Genderzeichen stoßen auf Kritik – auch mit Blick auf die Barrierefreiheit. Für Menschen, die nicht gut Deutsch können oder eine Leseschwäche, Hörbehinderung oder kognitive Einschränkungen haben, ist die Herausforderung umso größer. Daher rät etwa der Blinden- und Sehbehindertenverband von Sonderzeichen beim Gendern ab. Auch das Netzwerk Leichte Sprache rät davon ab und empfiehlt die Beidnennung.
Anders sieht das die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit in der Informationstechnik (BFIT-Bund). Die Überwachungsstelle hat im August 2021 eine Empfehlung zur Verwendung von gendergerechter, digital barrierefreier Sprache erstellt. Die Empfehlung basiert auf einer ersten überregionalen, repräsentativen Studie unter Einbezug der Menschen mit Beeinträchtigungen. Der BFIT-Bund spricht sich demnach für das Gendern mit dem Asterisk aus. Das Gendersternchen sei in digitalen Anwendungen barrierefreier und gebrauchstauglicher als der Doppelpunkt.
Gendern, der Duden und die Rechtschreibung: Bislang keine Reform
Für offizielle Rechtschreibregeln gibt es bisher keine Reform. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat Genderzeichen nicht in das amtliche Regelwerk der deutschen Sprache aufgenommen. Das Gremium ist der Auffassung, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll. Dies könne jedoch nicht mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung gelöst werden. Der Rechtschreibrat werde die weitere Schreibentwicklung beobachten, denn geschlechtergerechte Schreibung sei aufgrund des gesellschaftlichen Wandels und der Schreibentwicklung noch im Fluss.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat sich für einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch ausgesprochen, der verständlich, lesbar und regelkonform ist. Sonderzeichen werden von der Gesellschaft für deutsche Sprache aus diesem Grund nicht unterstützt.
Der Duden hat sein Online-Wörterbuch in gendersensible Sprache überarbeitet und damit für Aufsehen gesorgt. Der aktuelle Rechtschreib-Duden (28., völlig überarbeitete und erweiterte Ausgabe, August 2020) umfasst erstmals das Kapitel „Geschlechtergerechter Sprachgebrauch“, das unterschiedliche Optionen geschlechtergerechter Formulierungen aufzeigt, verbunden mit der Erläuterung: „Das Deutsche bietet eine Fülle an Möglichkeiten, geschlechtergerecht zu formulieren. Es gibt dafür allerdings keine Norm.“
Der sprachkonservative Verein Deutsche Sprache e. V. startete bereits mehrere Unterschriftenaktionen gegen das Gendern, so die Aktion „Schluss mit dem Gender-Unfug!“ oder als Reaktion auf den Duden die Aktion „Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden“. Darin spricht der Verein von einer „Zwangssexualisierung der deutschen Sprache“ und fordert den Duden auf, „seine Sexualisierungspläne zu überdenken, in Zukunft sensibel und behutsam mit der deutschen Sprache umzugehen und sich auf seine ursprünglichen Ziele zu besinnen“. Einigen Experten der Literaturwissenschaft geht die Kritik des Vereins zu weit: Man könne und solle über das Gendern diskutieren, aber manche Äußerungen des Vereins seien rechtspopulistisch und schössen über das Ziel hinaus (Quelle: Deutschlandfunk Kultur).
Transparenz
Wie gendert die LpB?
Die LpB strebt eine verständliche, lesbare und zugängliche Sprache an, die den jeweiligen Inhalt sachlich und sprachlich korrekt wiedergibt. Die LpB strebt zugleich einen geschlechtergerechten Sprachgebrauch an.
zum Weiterlesen
zum Weiterlesen
Dieser soll zum Ausdruck bringen, dass Frauen und Männer sowie Menschen mit anderen Geschlechtsidentitäten angesprochen und einbezogen werden. Die LpB setzt sich somit auch in ihrer sprachlichen Ausdrucksweise für eine pluralistische Gesellschaft ein, indem sie eine Bandbreite unterschiedlicher Ausdrucksformen pflegt. Daher will die LpB das generische Maskulinum nicht als alleinige und ausschließliche Ausdrucksform verwenden. Die erste Wahl ist die Ausschreibung von weiblicher und männlicher Form, verbunden mit dem Einsatz geschlechtsneutraler Bezeichnungen oder Umschreibungen. Auch eine weitere Form der gendergerechten Schreibweise, der sogenannte Gender:Doppelpunkt, kommt auf den Internetseiten und Social-Media-Kanälen der LpB zum Einsatz. Die geschlechtergerechte Sprache findet in vielen Formen ihren Ausdruck. Viele Fragen rund um das Gendern sind jedoch noch unbeantwortet und der Ausgang dieser Sprachdebatte ist noch nicht vorhersehbar.
Gibt es eine Gender-Pflicht?

Auf Landes- und Bundesebene existieren keine Gesetze zu einer Gender-Pflicht. Meinungen und Stellungnahmen aus unterschiedlichen Richtungen fließen in den Gender-Diskurs mit ein – aus Politik, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft. Gendergerechte Sprache offiziell einzuführen, wäre eine Entscheidung der Politik. Einige Stimmen aus der Politik wollen Gendersprache verbieten - oder haben Gendersprache mit Sonderzeichen verboten -, andere verpflichtend einführen.
Bei den Parteien gehen die Meinungen zum Genderthema weit auseinander. In den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2021 etwa hatten SPD, Grüne und Die LINKE Gendersternchen verwendet, zu dem Thema selbst äußerte sich nur die AfD (siehe dazu dw.com).
Wie bereits erwähnt, gibt es auch für die offiziellen Rechtschreibregeln keine Gender-Reform. Immer mehr Unternehmen, Medien, Hochschulen, Kommunen und Behörden erlassen allerdings eigene Leitfäden und Richtlinien zur geschlechtergerechten Sprache. Das bedeutet: In vielen Verwaltungen wird mit weiblicher und männlicher Form oder geschlechterneutralen Begriffen gearbeitet. Einige Stadtverwaltungen wie Hannover haben sogar die sprachliche Gleichbehandlung als Pflicht für den amtlichen Sprachgebrauch festgelegt. Die Berliner Verwaltung hingegen verzichtet nach Angaben des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) wieder auf Gendersprache, ein generelles Gender-Verbot aber lehnt Wegner ab. Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper hat z.B. in einem Rundschreiben an die Stadtverwaltung die Empfehlung ausgesprochen, in der Regel keine Gender‐Sonderzeichen zu verwenden.
Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat in einer Pressemitteilung festgehalten, dass in Hochschulen eine geschlechtergerechte Schreibung zunehme, die von den Regelungen im Amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung abweiche. „Inwieweit den Hochschulen das Recht zusteht, von der amtlichen deutschen Rechtschreibung abzuweichen, ist strittig. Hochschulen und Lehrende haben zu beachten, dass sie für die Bildung und Ausbildung der Lehrkräfte an öffentlichen Schulen Verantwortung tragen, in denen Schülerinnen und Schülern die Rechtschreibung nach dem Amtlichen Regelwerk zu vermitteln ist, auf das sich die zuständigen staatlichen Stellen der deutschsprachigen Länder verständigt haben.“
Wenn es um die sprachliche Darstellung von Frauen und Männern geht, heißt es im Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg: „Frauen und Männer führen alle Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in der jeweils ihrem Geschlecht entsprechenden Sprachform" (Paragraf 11,7) und „Frauen und Männer führen alle Hochschulgrade, akademischen Bezeichnungen und Titel in der jeweils ihrem Geschlecht entsprechenden Sprachform" (Paragraf 36,1).
Anrede „Herr“ und „Frau“
Interessant in diesem Kontext ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt a.M. vom Juni 2022: Eine nicht-binäre Person hatte gegen die binären Anreden „Herr“ und „Frau“ der Deutschen Bahn geklagt. Das Gericht entschied, dass die Bahn die Anreden durch weitere Ansprachen für Menschen mit dem Geschlechtsmerkmal „divers“ ergänzen muss. (Quelle)
Gibt es ein Gender-Verbot?
Eine bundeseinheitliche Regelung für ein Gender-Verbot gibt es nicht. In einigen anderen Bundesländern wird über ein Gender-Verbot in Schule und Verwaltung diskutiert oder es existieren bereits Vorschriften dazu, etwa in Sachsen, Bayern, Hessen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg oder Thüringen (Quelle ).
In Sachsen hat das Kultusministerium bereits 2021 entschieden, dass Gender-Sonderzeichen an Schulen nicht verwendet werden. Im Juli 2023 wurde das Verbot erweitert: Gendern ist in der schriftlichen Kommunikation für die Verwaltung, Schule, aber auch für Vereine, Stiftungen und Verbände, mit denen das Kultusministerium gemeinsam nach außen auftritt, verboten.
Die bayerische Landesregierung hat im März 2023 ein Verbot von Gendersprache beschlossen: Ab April 2024 ist es verboten, an Schulen, Hochschulen und Behörden zur Umschreibung von Geschlechtern Sonderzeichen zu verwenden. Somit dürfen geschlechtergerechte Formulierungen mit Hilfe von Sternchen, Binnen-I, Unterstrich und Doppelpunkt (z. B. Lehrer*innen, LehrerInnen, Lehrer_innen und Lehrer:innen) in der Schriftsprache nicht mehr verwendet werden. Das Verbot soll für offizielle Schreiben, Internetseiten von Behörden und Schulen, Elternbriefe, Schulbücher und Internetseiten gelten. (Quellen: BR, Deutschlandfunkkultur, Deutschlandfunk, Tagesspiegel)
In Baden-Württemberg hat die Landesregierung im Januar 2024 beschlossen, dass das Gendern mit Sonderzeichen im offiziellen Schriftverkehr der Landesbehörde verboten ist. Diese Regeln hätten vorher schon gegolten, sie seien nochmals klargestellt worden. Die Landesverwaltung habe laut Beschluss im förmlichen Schriftverkehr das amtliche Regelwerk der deutschen Rechtschreibung einzuhalten. Zuvor hatte das Innenministerium einen Antrag für ein Volksbegehren gegen eine Genderpflicht an Schulen und Behörden abgelehnt - aus formalen Gründen. (Quellen: SWR; SWR)
Warum ist die Debatte ums Gendern so kontrovers?

Ändern sich gesellschaftliche Verhältnisse, schlägt sich das in der Sprache nieder. Sprachdebatten sind also immer auch politische Debatten. Seit gegendert wird, gibt es einen Kampf gegen das Gendern. Es geht immer auch um kulturelle Dominanz und Macht, um Abgrenzung und um die individuelle wie nationale Identität, erklärt ein Artikel auf Deutschlandfunk. Der Beitrag führt Beispiele von Sprachdebatten aus der Geschichte auf, etwa Martin Luthers Forderung nach verständlichem Deutsch oder den Streit um Anglizismen.
Die heutige Debatte um das Gendern werde dadurch verstärkt, dass alle mitdiskutieren können und vielfältige Meinungen zum Tragen kommen. In der Diskussion steht auch der Umgang öffentlich-rechtlicher Medien mit dem Thema. Hinzu kommt, dass es vielfältige Formen des Genderns gibt. Auch darüber wird diskutiert: Sollen wir Bürger*innen, BürgerInnen, Bürger:innen, Bürgerinnen und Bürger oder Bürgerschaft schreiben?
Die Sprachdebatte ist noch längst nicht abgeschlossen, viele Fragen rund ums Gendern sind noch offen. Der Ausgang des Genderstreits ist noch nicht vorhersehbar, bilanziert der Artikel auf Deutschlandfunk. Letztlich kann die Wissenschaft zwar die Effekte von Sprache untersuchen und daraus Empfehlungen ableiten, heißt es in einem Artikel auf Quarks. Was sich im Sprachgebrauch durchsetzen wird, entscheiden am Ende allerdings wir selbst.
Pro und Contra: Was spricht für das Gendern – und was dagegen?
Diskussionen über eine geschlechtergerechte deutsche Sprache gibt es seit den 1970er Jahren. Die Positionen sind oft verhärtet. Wir wollen einen Überblick über die Pro- und Contra-Argumente geben und stellen jeweils acht Gründe, die für und gegen das Gendern sprechen, einander gegenüber.
Grafiken: LpB BW via Canva.
Quellen: quarks.de, geo.de, bpb.de, genderleicht.de, deutschlandfunk.de,idw-online.de, wdr.de
8 Gründe für Gendern
Die geschlechtergerechte Sprache ist ein wichtiger Aspekt, um die im Grundgesetz verankerte Gleichbehandlung der Geschlechter zu fördern.
Studien zeigen: Sprachen, die von Grund auf neutraler sind, könnten dafür sorgen, dass Menschen offener über Geschlechterrollen denken.
Sprachwandel empfinden Menschen grundsätzlich als negativ, das ist aus der Forschung bekannt. Unbekannte Wörter sind auch für unser Gehirn anstrengender – zunächst. Je öfter wir unbekannte Wörter verwenden, desto mehr neuronale Verknüpfungen bilden sich. Und umso leichter fallen uns die Wörter.
Sprache schafft Wirklichkeit. Wer sprachlich unterrepräsentiert ist, verliert an Bedeutung. Zudem wissen viele Menschen gar nicht, dass es außer Mann und Frau auch intersexuelle Menschen gibt.
Wer geschlechtersensibel schreiben und sprechen möchte, findet immer eine angemessene Lösung. Es gibt sehr viele Gendertechniken, die bei der Verwendung nicht einmal als bewusstes Gendern erkannt werden.
Sprache verändert sich, seit es Sprache gibt. Wir benutzen heute Wörter, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Im aktuellen Duden sind 3000 neue Wörter, darunter „gendergerecht“ und „transgender“. Wir passen die Sprache an die Welt an, in der wir leben.
Da die Gesellschaft nicht nur aus Menschen besteht, die sich als Mann oder Frau definieren, sind Gender-Zeichen die richtige Wahl. Selbst wenn es sich nur um wenige Menschen handelt, wird dadurch die sprachliche Inklusion offener.
Genderzeichen zu verwenden, bedeutet, sich politisch zu positionieren und mit all jenen solidarisch zu erklären, die eine neue, emanzipative Geschlechterordnung leben.
8 Gründe gegen Gendern
Rund zwei Drittel der wahlberechtigten Deutschen lehnen laut Meinungsumfragen eine gendergerechte Sprache ab.
Das generische Maskulinum ist eine grammatisch männliche Bezeichnung, hat mit dem biologischen Geschlecht aber laut Definition nichts zu tun. „Die Erzieher“ bezieht sich auf eine Gruppe von Menschen, die den Beruf ausüben – über das Geschlecht sagt der Begriff nichts aus.
Bei manchen Menschen erweckt Gendern den Eindruck, ein Sprachkorsett auferlegt zu bekommen. Gendern führt zu Reaktanz, also zum Widerstand gegen diese neuen Regeln, und könnte zu einer Rückkehr zu konservativen Wertvorstellungen in Bezug auf Geschlechtergleichheit führen.
Durch Gendern wird das Geschlecht überbetont. Auch in Fällen, in denen das Geschlecht gar keine Rolle spielt. Dadurch könnten Unterschiede noch mehr in den Vordergrund treten.
Verständliche, lesbare und zugängliche Sprache wird durch Gendern nicht gewährleistet. Sternchen und Passivkonstruktionen machen Texte leseunfreundlich und länger. Genderzeichen irritieren, die Sprachästhetik leidet und die gesprochene Pause klingt unnatürlich.
In Sachen Barrierefreiheit stößt das Gendern hin und wieder an seine Grenzen. Ob und wie Gendern in Leichter Sprache funktioniert, ist umstritten. Und der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband rät von Sonderzeichen beim Gendern ab. Die meisten Screenreader (Bildschirmleseprogramme) erkennen diese nicht.
Gendern ist ein akademisches Elitenprojekt und geht an der Lebens- und Sprachwirklichkeit vieler Menschen vorbei; es ist eine Bevormundung.
Gendern lädt Sprache politisch auf. Die gegenderte Sprache ist ein politisches Statement, das zur Polarisierung beiträgt.
zum Thema
Quellen & weitere Infos
Nützliche Links und Handreichungen zum Thema Gendern
Nützliche Links und Handreichungen zum Thema Gendern
- Gesellschaft für deutsche Sprache: Standpunkt und Leitlinien zum Gendering
- Genderleicht: Webseite des Journalistinnenbundes mit News, Infos und Tipps und Tools für eine gendersensible Arbeitsweise
- Genderleicht: Anleitung Gendern in Leichter Sprache
- Genderdings: Webseite rund ums Gendern, um Familienformen, Sexualität, Feminismus und mehr
- Geschicktgendern: Gender-Wörterbuch mit Formulierungshilfen und Links zu Handreichungen
- Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband: Stellungnahme Gendern
- Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit in der Informationstechnik (BFIT-Bund): Empfehlung zur Verwendung von gendergerechter, digital barrierefreier Sprache (PDF)
- Bundesverband der Kommunikatoren: Kompendium Gendersensible Sprache
- Duden: Sprachratgeber Gendern
- Rat für deutsche Rechtschreibung: Geschlechtergerechte Schreibung (12/2023)
- Wikipedia: Gendersternchen
- Wikipedia: Übersicht über Studien und Umfragen zu geschlechtergerechter Sprache
- Handreichung: Geschlechterinklusive Sprache an Hochschulen fördern
- Leitfaden für eine geschlechtersensible Sprache (Gleichstellungsbeauftragte der Universität Köln, 2021)
- Juraforum.de: Rechtslage in Privatwirtschaft und öffentlicher Verwaltung
Gendern einfach erklärt
Gendern einfach erklärt
- ZDF-Logo: Was bedeutet Gendern?
- Kindersache.de: Gendern kindergerecht erklärt
- Informationen in Leichter Sprache: Männlich, weiblich, divers (PDF)
- Genderleicht: Gendern erklärt in leichter Sprache
Links zum Streitpunkt Gendern
Links zum Streitpunkt Gendern
- Bundeszentrale für politische Bildung: Geschlechtergerechte Sprache (Aus Politik und Zeitgeschichte 2022)
- Berliner Zeitung: Nein, die deutsche Sprache diskriminiert Frauen nicht (7/2022)
- Deutschlandfunk: Aus früheren Sprachdebatten lernen (7/2021)
- Deutschlandfunkkultur: Helfen * bei der Gleichstellung? (2/2021)
- Deutsche Welle: Die große Debatte ums Sternchen (7/2021)
- Die Tagespost: Wie stehen die Parteien zum Gendern? (7/2021)
- Duden: Pressemitteilung: 3000 neue Wörter im Duden
- Focus: Geichberechtigung in der Sprache (3/2021)
- Genderleicht: Gendern in leichter Sprache Anleitung
- Geo-Magazin: Pro- und Contra-Liste Gendern (8/2021)
- NDR: Geht der Duden zu weit? (2/2021)
- Schulportal: Gendern in der Schule (4/2021)
- SWR: Pro und Contra: Mit oder ohne Gender-Sternchen? (2/2021)
- taz: Gendern als Ausschlusskriterium (7/2021)
- Tagesschau: Streit über geschlechtergerechte Sprache (6/2021)
- Tagesschau: Tagesthemen Geschlechtergerechte Sprache (6/2021)
- Quarks: Was Gendern bringt und was nicht (3/2021)
- Wikipedia: Geschlechtergerechte Sprache - Links zu Debatten
- Zeit: Podcast: Sprachzwang oder Gerechtigkeit? (2/2021)
Dossiers und Themenseiten zu Diversity
Dossiers und Themenseiten zu Diversity
- BpB-Dossier: Geschlechtliche Vielfalt – trans*
Das Dossier thematisiert soziologische, rechtliche und soziale Aspekte von trans* und nicht-binärem Leben.
- LpB-Dossier: Diversity
Was ist Diversity? Und was ist Gender Mainstreaming? Und muss Diversity sein? Diese Fragen greift das Dossier auf.
- Bundesfamilienministerium: Geschlechtliche Vielfalt
Die Themenseite des Bundesfamilienministeriums zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen und geschlechtlicher Vielfalt.
- Antidiskriminierungsstelle: Geschlecht und Geschlechtsidentität
Die Themenseite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes beantwortet häufig gestellte Fragen zum Thema trans*.
- Video-Reihe #wtf?! Wissen Thesen Fakten
Journalist und MrWissen2go Mirko Drotschmann fragt, wie es mit der Gleichberechtigung in Deutschland aussieht.
- Video: maiLab: Die Wissenschaft hinter Transgender
Wissenschafts-YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim erklärt auf ihrem Kanal „MaiLab“, was die biologische und neurowissenschaftliche Forschung bisher über das „Transgender-Gehirn“ herausgefunden hat.
Materialien für den Unterricht
Materialien für den Unterricht
Mach es gleich! (PDF): Lehr- und Lernmappe für Theorie und Praxis zum Thema Gender und Schule für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern ab zwölf Jahren.
Gendern in der Schule: Dossier zum Thema Gendern in der Schule auf dem Deutschen Schulportal. Es geht unter anderem um die Fragen: Wie gendern Schulen? Wo passt das Thema in den Unterricht?
Genderaspekte im Unterricht: Themendossier auf lehrer-online.de mit Unterrichtsmaterial, das sich Gender-Themen wie Rollenbildern von Mann und Frau, Geschlechterklischees, Gleichberechtigung, Sexismus etc. widmet.
Film „Sie, er oder wer? - Transgender“: Die Sendungen von Planet-Schule.de können für den Einsatz im Unterricht heruntergeladen oder direkt gestreamt werden.
Was geht? Das Heft über Geschlechter, Liebe und Grenzen: Mit vielen Fragen und Formaten wie ein Quiz und Comics regt das Heft der Bundeszentrale für politische Bildung (2021) Jugendliche zum Nachdenken an.
Plattform „Mein Testgelände“: Plattform rund um das Thema Gender und Diversität. Die Themen werden in Form von Videos, Audios und Texten von Jugendlichen für Jugendliche ausgearbeitet und produziert.
Autor: Internetredaktion der LpB BW | Stand der Aktualisierung: März 2024