Dossier
Netzpolitik
Die Politik über, mit und durch das Netz

Technologie und Digitalisierung haben unsere Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert: Die Art, wie wir kommunizieren, Gesellschaft leben, wie wir die Welt und Informationen über sie wahrnehmen. Dabei gibt es enorme Potentiale neuer Technologien, aber auch viele Risiken.
Ein breites Themenspektrum, von Cybermobbing an Schulen oder der Debatte um das Urheberrecht und "Artikel 13", über die Macht der Internetkonzerne und ihrer Algorithmen bis hin zur Frage, ob Pflegeroboter in Altersheimen eingesetzt werden sollen, die aber teilweise nicht einmal WLAN haben, beschreibt der Begriff "Netzpolitik". Netzpolitik ist die Politik über, mit und durch das Netz.
Warum ist Netzpolitik wichtig? Die Digitalisierung ist schon lange nicht mehr aufzuhalten. Sie beeinflusst den Alltag des Einzelnen, die Politik und unsere Gesellschaftsstruktur. Wie sich Netzpolitik entwickelt, daran kann jeder Bürger und jede Bürgerin mitwirken.
Dieses Dossier bietet einen Überblick über Netzpolitik und netzpolitische Themen, die politischen Entscheidungen und die beteiligten Akteure.
Bundesweite Aktionstage Netzpolitik & Demokratie
Für alle, die den digitalen Teil ihres Alltags mitgestalten wollen: Jedes Jahr finden die bundesweiten Aktionstage Netzpolitik & Demokratie statt, veranstaltet von den Zentralen für politische Bildung und ihren Partnern.
Was ist Netzpolitik? Ein Definitionsversuch

Algorithmen, die Macht der Internetkonzerne, Fake News, digitale Freiheit in China, autonomes Fahren - das alles sind netzpolitische Themen. Der Begriff Netzpolitik beschreibt so viele unterschiedliche Themen, dass er nicht klar definiert ist und im Alltag unterschiedlich verwendet wird. Oft wird Digitalisierung noch mit Netzpolitik gleichgesetzt - doch das greift viel zu kurz.
Netzpolitik ist mehr als Digitalisierung oder das Internet
Die Technologie verändert unsere Gesellschaft, unsere Kommunikation, den Informationsfluss, unsere Wahrnehmung der Welt dermaßen tiefgreifend, dass Netzpolitik mehr sein muss als reine Technologie.
Deswegen erscheint die Definition des Dudens, der Netzpolitik als „Gesamtheit der staatlichen Maßnahmen, die auf die Schaffung verbindlicher Rahmenbedingungen für den Betrieb und die Nutzung des Internets zielen“ beschreibt, unzureichend.
„Online und offline werden nicht mehr sauber zu trennen sein, sondern sich mehr und mehr ineinander verzahnen. Am Ende steht eine veränderte Gesellschaft.“
Markus Beckedahl, Netzpolitik.org, in: Die digitale Gesellschaft. Netzpolitik, Bürgerrechte und die Machtfrage. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG. München. Warum Netzpolitik alle etwas angeht. S. 213.
Eine breitere Definition, die die verschiedenen Ebenen der Thematik berücksichtigt, bietet die Online Enzyklopädie Wikipedia:
Netzpolitik bezeichnet ein Politikfeld rund um medienkulturelle, medienpolitische und medienrechtliche Fragen. Es geht darum, inwieweit sich die digitale, weltweit vernetzte Medientechnologie auf Kultur, Politik, Medien und Wirtschaft auswirkt, und wie diese wiederum die digitale Medientechnologie bedingen. Netzpolitische Fragen werden vom aktuellen Stand der digitalen Technik bestimmt.
Man kann Netzpolitik in drei Bereiche unterteilen:
Hintergrund zur Definition
Hintergrund zur Definition
Dem Politologen Samuel Greev zufolge hat sich für die auf der politischen Ebene mit der Digitalisierung verbundenen Themenfelder im letzten Jahrzehnt der Begriff der Netzpolitik etabliert.1 Dabei steckt Netzpolitik aber politisch noch in den Anfangsschuhen, handelt es sich bislang noch um „kein etabliertes Politikfeld, sondern um ein ‚Politikfeld im Entstehen“.2 Digitale Themen sind bereits in der Politik angekommen, wie in Kommissionen der Regierung oder Arbeitskreisen der Parteien, es gibt aber noch kein eigenes Internetministerium.3 Netzpolitik wird überdies von vielen nichtstaatlichen Akteuren beeinflusst.
1Samuel Greef. Netzpolitik - Entsteht ein Politikfeld für Digitalpolitik? © 2017, kassel university press GmbH, Kassel, S. 9.
2 Ebd. S. 11.
3 Vgl. ebd.
Netzpolitische Akteure

Unternehmen, Organisationen und Menschen können Einfluss darauf haben, was im Netz passiert. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich eine Art Netzkultur entwickelt, die sich mit netzpolitischen Fragen beschäftigt.
Im Bundestag
Bundesregierung
- Bundesministerium für Digitales und Verkehr
- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
- Kommission Wettbewerbsrecht 4.0
- IT-Planungsrat
Parteien
Die Parteien haben sich inzwischen dem Thema Netzpolitik in Arbeitskreisen und Gemeinschaften angenommen.
| Partei | Bund | Land |
|---|---|---|
| CDU / CSU | (CDU-naher Verein: cnetz) (CSU-naher Arbeitskreis: CSUnet) | Kommission Digitalisierung |
| SPD | (SPD-naher Verein: D64) | Forum Netzpolitik |
| AfD | AK digitale Agenda | AG Digitalpolitik in der AfD |
| FDP | BFA Medien, Internet und Digitale Agenda (FDP-naher Verein: LOAD) | LFA Internet und Medien |
| Die Linke | BAG Netzpolitik | LAG Digitale Linke |
| GRÜNE | LAG Medien- und Netzpolitik |
Zivilgesellschaftliche Akteure, Vereine und mehr
Informationen zum Thema Netzpolitik liefert Netzpolitik.org. Auch auf der jährlichen Veranstaltung re:publica werden viele netzpolitische Themen in Fachvorträgen diskutiert, teilweise sind diese kostenfrei auf Youtube.
Weitere Akteure sind zum Beispiel:
- Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung
- Bundesverband digitale Wirtschaft
- Chaos Computer Club
- Deutsche Vereinigung für Datenschutz
- Digitalcourage
- Digitale Gesellschaft
- Förderverein Freie Netzwerke
- Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung
- Freifunk
- Initiative D21
- Institut für digitale Ethik
- Internet Society German Chapter
- Gesellschaft für Freiheitsrechte
- Renewable Freedom Foundation
- Selbstbestimmt Digital
Politik des Netzes: Digitale Infrastruktur in Deutschland
Zwischen Glasfaser und Funkloch

Unser digitales Straßennetz
Schlaglöcher auf dem digitalen Straßennetz
Bevor sich als Gesellschaft das Netz gestalten lässt, muss es auch erst einmal einwandfrei funktionieren. Deutschland hat noch nicht die notwendige Infrastruktur, damit alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen am Netz teilhaben können.
Insbesondere in ländlichen Gegenden Deutschlands existieren bis heute Funklöcher, einige Gegenden haben keinen Zugang zu "schnellem Internet". In der analogen Welt wäre das mit Schlaglöchern auf den Straßen vergleichbar, fehlenden Straßenabschnitten - oder einem LKW, der über einen Feldweg seine Waren anliefern muss.
"Leistungsfähige Breitbandnetze zum schnellen Informations- und Wissensaustausch sind für Wirtschaft und Gesellschaft eine ebenso bedeutende Infrastruktur wie gut ausgebaute Straßen oder Schienennetze."
Bundesnetzagentur zum Thema Breitband, 2019 (zur Quelle)

Hintergrund: Breitband - die Technologien für schnelles Internet
Info: Was ist eigentlich Breitband?
Info: Was ist eigentlich Breitband?
Umgangssprachlich meinen wir mit Breitband ein „schnelles Internet“. Der Begriff Breitband beschreibt verschiedene Internetzugänge, die sich durch eine hohe Datenübertragungsrate auszeichnen. In Deutschland existieren hauptsächlich fünf Technologien, um über Breitband ins Internet zu gelangen:
- DSL und VDSL,
- Kabel-Internet,
- Glasfaser,
- Satelit,
- LTE.
Wie hoch die mögliche Geschwindigkeit ist, mit der man seinen Breitbandanschluss nutzen kann, beschreibt das Maß „Bandbreite“. Je höher die Bandbreite, desto mehr Informationen können in kurzer Zeit übertragen werden.
Eine bindende Definition für die Bezeichnung Breitband und wie „schnell“ Breitband sein muss, gibt es jedoch noch nicht, daher dürfen sich viele Technologien Breitband nennen. Das statistische Bundesamt legt zum Beispiel eine Datenübertragungsrate von 30 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) als Grundlage für Breitband an.
Bis 2025 möchte die Bundesregierung 100 Prozent der Anschlüsse über Breitbandnetze versorgen. Die aktuellen Förderungen können jedoch nur 70 Prozent der Haushalte mit Gigabit-Anschlüssen ausstatten, so ein Gutachten des TÜV Rheinlands. Der komplette Ausbau bis 2025 ist bisher unrealistisch.
Mehr zum Thema Breitbanden finden Sie hier sparhandy.de: Breitband
Der Breitbandatlas
Der Breitbandatlas
Der Breitbandatlas ist das zentrale Informationsmedium zur aktuellen Breitbandversorgung in Deutschland. Anhand von interaktiven Karten wird gezeigt, welche Bandbreiten und Techniken für die Datenübertragung zur Verfügung stehen. Die Anzeige in der Karte kann von ganz Deutschland bis auf Ebene eines Orts- bzw. Stadtteils navigiert werden.
Warum ist Glasfaser wichtig? Wofür braucht man Glasfaser?
Warum ist Glasfaser wichtig? Wofür braucht man Glasfaser?
Glasfaserkabel versprechen schnelleres Internet: Glasfaser ist eine Technologie, die im Zusammenhang zu leistungsstarkem und schnellem Internetzugang steht.
Die Vorteile
Mithilfe von Glasfaserkabeln lassen sich Daten über Lichtimpulse übertragen. Damit haben sie einige Vorteile gegenüber Kupferkabeln, die Daten mithilfe langsamerer elektischer Signale weiterleiten. Die Glasfasertechnologie bleibt gegenüber elektromagnetischen Einflüssen deutlich unempfindlicher. Daten können über längere Distanzen ohne Verstärkung übertragen werden. Licht codiert außerdem mehr Daten als elektrische Signale, die Übertragungskapazität ist ungleich größer.
Die Nachteile
Ihr Nachteil ist, dass sie deutlich empfindlicher sind, wenn sie zum Beispiel gebogen werden oder sonst in irgendeiner Weise mechanische Belastung erfahren. Kabelbrüche sind bei Glasfaserkabeln daher wahrscheinlicher. Glasfaserkabel werden daher in den Boden verlegt - das kostet.
Nichtsdestotrotz gilt Glasfaser als das Übertragungsmedium der Zukunft.
(Quelle: Philipp Offenbächer (2019): Die Regulierung des Vectoring, S. 55ff. Nomos Verlagsgesellschaft.)
Kritiker
Es gibt auch kritische Stimmen, die den Nutzen für den Ottonormalverbraucher anzweifeln, da die Verlegung neuer Kabel teuer ist und häufig auf die Endkunden umgelegt wird, der normale Bürger und die normale Bürgerin jedoch selten die größere Datenkapazität benötigen (Beispielhaft: Kommentar auf heise.de zum Glasfaserausbau).
Welche Netzanbieter gibt es?
Welche Netzanbieter gibt es?
In Deutschland gibt es aktuell drei Netzanbieter:
- Telekom
- Vodafone
- Telefónica Deutschland (o2)
- (Sobald 5G eingeführt wird: Drillisch (1&1))
Mobilfunkstandards: Was ist eigentlich LTE oder 5G?
Mobilfunkstandards: Was ist eigentlich LTE oder 5G?
LTE, 3G oder doch nur E? Viele Smartphones zeigen kleine Symbole, wie gut ihre Internetzugang ist. Was bedeutet das eigentlich? Diese Begriffe weisen auf Mobilfunkstandard Generationen hin.
Mobilfunkstandards ermöglichen die Datenübertragung auf unser Smartphone.
Sie sind in Generationen unterteilt, zum Beispiel 2G für die zweite Generation. Die mobile Datenübertragung wird von Generation zu Generation schneller und störungsfreier. Mit 3G begann übrigens der große Durchbruch des mobilen Internets, der Welt in unserer Hosentasche.
Die Buchstaben am Smartphone zeigen an, wie schnell das schnellstmögliche verfügbare Mobilfunknetz gerade ins Internet kommt. G und E weisen auf das alte 2G-Netz hin, U und H auf 3G, LTE auf 4G.
(Mehr: sparhandy: Mobilfunkstandardübersicht)
Netzpolitik auf europäischer Ebene
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Überblick über die Datenschutz-Grundverordnung
Die DSGVO wurde verabschiedet, um ein einheitliches Regelwerk für Datenschutz und freien Datenverkehr innerhalb der Europäischen Union (EU) zu gewährleisten und Individuen mehr Kontrolle über ihre Daten zu geben. Zuvor galten die unterschiedlichen nationalen Regelungen der Mitgliedsstaaten. Seit 25. Mai 2018 ist die Verordnung in allen EU-Mitgliedsländern gültig.
Datenschutz und Datenverkehr
Die DSGVO räumt Individuen mehr Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten ein. So ist laut der Verordnung die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne die ausdrückliche Einwilligung durch die jeweilige Person verboten. Die DSGVO gibt Individuen außerdem beispielsweise das Recht, von Unternehmen und Einrichtungen Auskunft über die über sie erhobenen Daten zu erhalten und diese auf Anfrage löschen zu lassen ("Recht auf Vergessenwerden").
Zudem vereinfacht ein einheitlicher Rechtsrahmen zum Datenschutz den Datenverkehr innerhalb der EU. Die DSGVO dient also dazu, den digitalen Binnenmarkt zu vervollständigen.
Umsetzung
Halten Einrichtungen oder Unternehmen die DSGVO nicht ein, drohen ihnen hohe Geldstrafen. Um die rechtliche Anwendung der DSGVO zu kontrollieren und durchzusetzen, hat die EU eine eigene Aufsichtsbehörde, den Europäischen Datenschutzausschuss, eingerichtet. Der Ausschuss setzt sich aus den jeweiligen Aufsichtsbehörden der Mitgliedsstaaten zusammen.
Mehr Informationen zur DSGVO
Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat: Datenschutz-Grundverordnung
Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union
Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union
Was ist die Digitalcharta?
Die „Charta der Digitalen Grundrechte der Europäischen Union“ (kurz: Digitalcharta) ist eine Sammlung von Grundrechten für den digitalen Raum auf europäischer Ebene. Die Digitalcharta ist jedoch kein allgemeingültiges, verbindliches Regelwerk der Europäischen Union, sondern ein Vorschlag dafür aus der Gesellschaft.
Wie entstand die Digitalcharta?
Die Digitalcharta wurde unter dem Dach der Zeit-Stiftung von Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet, die in den Bereichen Politik, Wissenschaft, Journalismus, Netz-Aktivismus oder Bürgerrechte aktiv sind. 2016 veröffentlichten die Beteiligten die Charta und legten sie dem Europäischen Parlament als Vorschlag für einen verbindlichen Rechtsrahmen vor. Auf der Grundlage von Rückmeldungen und Kritik aus der Gesellschaft wurde 2018 eine überarbeitete Fassung herausgebracht.
Mehr zur Digitalcharta
Netzpolitik auf Bundesebene
Maßnahmen der Bundesregierung
Maßnahmen der Bundesregierung
Koalitionsvertrag
Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung von SPD, Grünen und FDP unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird den Themen Netzpolitik und Digitalisierung mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als unter der Vorgänger-Koalition aus CDU und SPD unter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Bundesministerium für Digitales und Verkehr unter Minister Volker Wissing (FDP) und im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter Minister Robert Habeck (Grüne) sind die digitalen Themen verortet.
Deutschland braucht einen umfassenden digitalen Aufbruch. Wir wollen das Potenzial der Digitalisierung für die Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen, für Wohlstand, Freiheit, soziale Teilhabe und Nachhaltigkeit nutzen.
Auszug aus dem aktuellen Koalitionsvertrag.
Kernpunkte der Digitalstrategie sind die Punkte
- digitaler Staat und digitale Verwaltung,
- digitale Infrastruktur,
- digitale Bürgerrechte und IT-Sicherheit,
- Nutzung von Daten und Datenrecht,
- digitale Gesellschaft, digitale Schlüsseltechnologien,
- Nachhaltigkeit in der Digitalisierung,
- und digitale Wirtschaft.
Auf der Seite netzpolitik.org finden Sie wichtige netzpolitische Punkte noch einmal zusammengefasst und bewertet.
Digitale Agenda
Die Bundesregierung will mit einer Digitalen Agenda Rahmenbedingungen für den digitalen Wandel schaffen. Ihre Kernpunkte sind 1. Digitale Infrastrukturen 2. Sicherheit, Schutz und Vertrauen für digitale Infrastrukturen und 3. Digitale Wirtschaft und Digitales Arbeiten. Für die Umsetzung und Weiterentwicklung der digitalen Agenda sollen sich der Deutsche Bundestag, die Länder und Kommunen, die Zivilgesellschaft, die Wirtschaft und Wissenschaft ebenso wie die Tarifpartner, die Beauftragten für den Datenschutz und Vertreterinnen und Vertreter der Netzcommunity eng und dauerhaft beteiligen.
Bundesregierung: Digitale Agenda
Digitalgremien
Die Bundesregierung hat verschiedene Gremien eingerichtet, die die Bundesregierung zum Thema Digitalisierung beraten oder Handlungsempfehlungen erarbeiten sollen.
IT-Beauftragter: Markus Richter
Markus Richter, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, ist Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Er fungiert als zentraler Ansprechpartner für Länder und Wirtschaft bei der Zusammenarbeit mit der Bundesregierung in IT-Fragen.
Bundestag: Gesetze zu Digitalisierung
Bundestag: Gesetze zu Digitalisierung
Überblick über Gesetze mit digitalem Bezug
Der Deutsche Bundestag hat in der 18. und 19. Wahlperiode folgende Gesetze mit Bezug zur Digitalisierung verabschiedet:
- das Dritte Telemedien-Änderungsgesetz (WLAN-Gesetz)
- das Urheberrechts-Wissensgesellschaftsgesetz (UrhWissG)
- das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)
- das Bundesdatenschutzgesetz
- das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)
Ausgesetzt: Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung
Etwas in der Luft hängt das vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Das Gesetz sollte eigentlich Internetanbieter in Deutschland dazu verpflichten, ab dem 1. Juli 2017 Kommunikations- und Standortdaten für eine bestimmte Zeit zu speichern. Der Europäische Gerichtshof erklärte jedoch die anlasslose Vorratsdatenspeicherung im Dezember 2016 für unzulässig. Aus diesem Grund wurde die Vorratsdatenspeicherung bisher nicht umgesetzt.
Mehr zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland auf datenschutz.org
Genauer im Blick: das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG)
Das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (umgangssprachlich auch: Facebook-Gesetz) soll gegen Hetze und Hass im Netz vorgehen. Es verpflichtet soziale Netzwerke, rechtswidrige Inhalte konsequent zu entfernen. Löschen die Unternehmen strafbare Inhalte nicht innerhalb eines Tages nach Eingang einer Beschwerde, drohen ihnen hohe Geldstrafen. Als problematisch daran wird gesehen, dass die Strafbarkeit von Inhalten durch Unternehmen und nicht durch unabhängige Gerichte beurteilt wird. Aus Angst vor hohen Geldstrafen tendieren die Unternehmen dazu, mehr Inhalte als nötig zu löschen, beispielsweise Satire. Kritiker sehen darin eine unverhältnismäßige Gefährdung der Meinungsfreiheit.
Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)
Das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) soll eine bessere Gesundheitsversorgung durch Digitalisierung und Innovation gewährleisten. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: Apps auf Rezept, Videosprechstunden einfach zu nutzen und überall bei Behandlungen auf das sichere Datennetz im Gesundheitswesen zuzugreifen. Das vom Bundestag verabschiedete Gesetzt trat am 19. Dezember 2019 in Kraft.
Netzpolitik in Baden-Württemberg
Digitalisierung in der Wirtschaft in Baden-Württemberg
Digitalisierung in der Wirtschaft in Baden-Württemberg
Die Digitalisierung der gewerblichen Wirtschaft ist in Baden-Württemberg bereits etwas weiter vorangeschritten als auf Bundesebene. Das haben der Wirtschaftsindex DIGITAL, Kantar TNS und ZEW im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg im Monitoring-Report Wirtschaft DIGITAL von 2020 veröffentlicht.
Baden-Württemberg erreicht demnach beim Digitalisierungsgrad seiner gewerblichen Wirtschaft 55 von 100 möglichen Indexpunkten. Der Digitalisierungsgrad hat demnach in einer Reihe von Branchen zugenommen (IKT-Wirtschaft, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Ver kehr- und Logistik, Chemie- und Gesundheitsindustrie, sonstiges verarbeitendes Gewerbe). Ein Schwerpunkt der diesjährigen Studie lag auf der Befragung zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in den teilnehmenden Betrieben. Hervorzuheben ist, dass sich die Nutzungsrate von KI-Lösungen seit 2017 auf acht Prozent verdoppelt hat. Bis 2030 planen 34 Prozent der Befragten, KI-Lösungen zu nutzen.
digital@bw
digital@bw
Baden-Württemberg hat 2017 die Digitalisierungsstrategie digital@bw erarbeitet. Mit entsprechenden Projekten und Maßnahmen will das Land „Leitregion des digitalen Wandels“ werden. Die Landesregierung legt besondere Schwerpunkte auf die Themen digitale Bildung, die Digitalisierung im Mittelstand bei Handwerk, Handel und Dienstleistungsgewerbe und die Weiterentwicklung des automatisierten Fahrens.
Innenministerium Baden-Württemberg: Digitalisierung
CIO Baden-Württemberg: Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnologie
Breitbandgeschwindigkeit in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg kommen Bürgerinnen und Bürger je nach Wohnort oft noch nicht gleich schnell ins Internet. Mehr dazu erfahren Sie im Breitbandatlas für Baden-Württemberg.
Wie steht es um den Ausbau des Mobilfunknetzes in Baden-Württemberg?
Die Mobilfunkversorgung in Baden-Württemberg ist besser geworden, die Mobilfunkanbieter erfüllen aber noch nicht die Versorgungslage, für die sie sich 2015 mit dem Erwerb der Lizenzen verpflichtet hatten.
Lesen Sie mehr in Fragen und Antworten zu Mobilfunk und 5G in Baden-Württemberg!
Digitalisierung
Video: Blick. Einfach erklärt Digitalisierung. YouTube.
Digitalisierung bezeichnet im ursprünglichen Sinn das Umwandeln von analogen Werten in digitale Formate. Diese Daten lassen sich informationstechnisch verarbeiten. Oft steht der Begriff Digitalisierung aber auch für die digitale Revolution oder die digitale Transformation (Quelle: bigdata-insider.de).
Die umfassende Digitalisierung der Welt ist heute kein Neuland mehr. Als Produzent, Konsument oder Prosument (Konsumenten, die zugleich Produzenten sind oder auch Produzenten, die zugleich als Konsumenten auftreten) nimmt jeder Mensch mehr oder weniger aktiv an der Digitalisierung teil. Unsere Alltagswelt ist digital geworden.
Dossiers zu Netzpolitik und Digitalisierung der LpB BW

Netzpolitik
Politik über, mit und durch das Netz
Von der Breitbandabdeckung über Datenschutz zu Cybermobbing: Dieses Dossier vermittelt ein netzpolitisches Grundverständnis. Es beschreibt aktuelle Entwicklungen wie zum Beispiel die Frage nach Medienkompetenz als Unterrichtsfach, erklärt politische Entscheidungen und listet netzpolitische Akteure auf.
mehr
Fake News
Definition, Verbreitung und Auswirkung
Was es mit Fake News genau auf sich hat, welche teils gefährlichen Auswirkungen sie haben können, wer sie verbreitet, wie sie strafrechtlich einzuordnen sind und wie man Fake News erkennt erfahren Sie unter anderem in diesem Dossier.
mehr

Verschwörungstheorien
Was sind Verschwörungstheorien und wie funktionieren sie? Welche Rolle spielt das Internet bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien? Worin bestehen die Gefahren von Verschwörungstheorien? Und wie können sie entkräftet werden? Das sind die Kernthemen dieses Dossiers.
mehr

Hate Speech
Was können wir gegen Hass im Netz tun?
Hasspostings enthalten Äußerungen, die Einzelne oder Gruppen diskriminieren, zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, Religion oder sozialen Zugehörigkeit. Wie können wir damit umgehen? Wo gibt es Hilfe im Netz?
mehr
Digitale Demokratie
E-Partizipation, Open Government, Online-Wahlen
Politik findet zunehmend digital statt. Was bedeutet digitale Demokratie? Reicht es, demokratische Prozesse ins Digitale zu verlagern? Wie können wir das Netz zu einem demokratischen Raum gestalten? Das Dossier gibt Antworten auf diese Fragen und erklärt die wichtigsten Begriffe rund um das Thema digitale Demokratie, Open Government und Online-Wahlen.
mehr
Datenschutz am Smartphone
Praktische Tipps und Ihre Rechte
Das Smartphone ist ein Instrument zur demokratischen Teilhabe. Doch haben wir die digitalen Spuren im Blick, die wir auf dem Smartphone hinterlassen? Welche Handy-Einstellungen schützen uns? Diese Seite dient als praktische Hilfe, das eigene Smartphone zu sichern, und klärt über die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern auf.
mehr

Digitaler Unterricht mit Moodle, H5P und BigBlueButton
Handreichung für Lehrkräfte
Die Nachfrage an Wissen über digitale Lehrmöglichkeiten ist durch die Corona-Pandemie enorm gestiegen. Diese Seite bietet einen Überblick über die Plattform Moodle, das Videokonferenzsystem BigBlueButton und die interaktiven Softwarelösungen von H5P für Lehrkräfte.
mehr
Autonomes Fahren und digitale Ethik
Der Mensch im automatisierten Fahrzeug
Wie soll sich ein "selbstdenkendes" Fahrzeug im Fall eines Unfalls verhalten? Digitale Ethik kann und muss bei diesen Fragen helfen. Dieses Dossier sensibilisiert für die ethischen Fragen im Bereich der Technikentwicklung und zeigt am konkreten Beispiel autonomen Fahrens, was digitale Ethik ist.
mehr

Digitaler Wahlkampf
Auf Stimmenfang im Netz
Wegen der Corona-Pandemie verlagert sich der Wahlkampf überwiegend ins Netz. Doch was heißt digitaler Wahlkampf über soziale Medien? Und was bedeutet das für Parteien, Kandidierende und die Wählerschaft? Unser Dossier bietet einen Überblick.
mehr

Digitalpolitik der EU
Auf dem Weg zu Europäischer Souveränität?
Die Themen Digitalpolitik und Digitalisierung beschäftigen die Europäische Union (EU) seit vielen Jahren. Der Bereich umfasst komplexe Fragen und Probleme sowie ganz unterschiedliche wirtschaftliche Chancen und politische Herausforderungen.
mehr
E-Learning-Kurse zu netzpolitischen Themen der LpB BW
Anmeldepflichtige E-Learning-Kurse
Digitale Ethik
E-Learningkurs mit Videokonferenz (ChatGPT & Co – Künstliche Intelligenz einordnen und verstehen)
Der E-Learning-Kurs „Digitale Ethik" bietet Beschäftigten des Landes Baden-Württemberg und Sachsen sowie Interessierte die Möglichkeit sich mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Lebensbereiche auseinanderzusetzen. Thema: Wie stärkt unsere digitale Realität das demokratische Gemeinwesen?
Programm und Anmeldung

Datenkompetenz für eine digitale Demokratie
Wer sieht mich?
Der E-Learning-Kurs mit tutorieller Begleitung gibt einen Überblick über die Bedeutung digitaler Daten für unsere Demokratie. In Kooperation mit der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Sabine Grullini.
Programm und Anmeldung
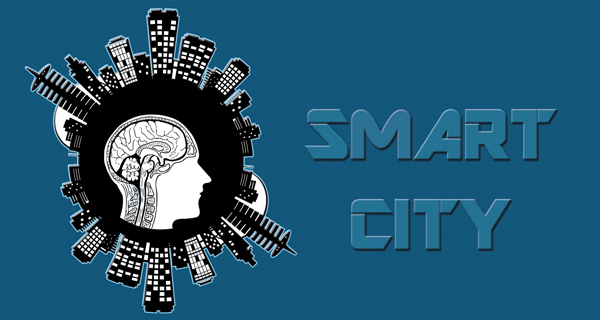
Unsere smarte Stadt
Digitalisierung, die das Gemeinwesen stärkt
Dieser E-Learningkurs möchte Bürgerinnen und Bürger sowie weitere kommunale Akteure darüber ins Gespräch bringen, wie digitale Technologie den sozialen Zusammenhalt stärken kann.
mehr

Digitale Ethik
Digitalisierung ist bereits jetzt Alltag und durchdringt zunehmend weitere Lebensbereiche. Technische Errungenschaften müssen ethisch begleitet werden - diese Diskussion wollen wir in dem tutoriell moderierten E-Learningkurs gemeinsam führen.
mehr

Demokratie geht digital!
Online-Petitionen, Social-Media, Bundestags-Apps: der digitale Wandel verändert auch unsere Demokratie. Welche digitalen Möglichkeiten stärken sie, welche Auswirkungen sind problematisch? Diskutieren Sie mit uns 4 Wochen online, wie wir das Netz demokratischer machen.
mehr
Kostenfreie E-Learning-Kurse für Schulklassen

Cyber Stories
Künstliche Intelligenz (KI) macht Geschichte
In diesem offenen E-Learning-Kurs lernen Schüler:innen grundlegende Aspekte von KI kennen, wenden diese an und reflektieren sie. Empfohlen ab der 7. Klasse. Ein Begleitheft gibt Lehrkräften Hilfestellung beim Einsatz im Schulunterricht.
Cyber Stories

Unser Staat, unsere Daten!
Das Recht auf Informationsfreiheit und Transparenz
Der offene Online-Kurs für den Unterricht zeigt, wie Jugendliche ihr Recht auf Informationen nutzen können. Empfohlen ab 9. Klasse. Ein Leitfaden und ein inhaltliches Informationsblatt geben Hilfestellung beim Einsatz im Schulunterricht.
Unser Staat, unsere Daten!

Mit Herz gegen Hate Speech!
Sensibilisierung für einen fairen Umgang miteinander
Der Online-Kurs ist kostenlos nutzbar, empfohlen ab Klasse 7.
Mit Herz gegen hate speech!

Daten verraten
Meine Persönlichkeit im Netz
Kostenlos nutzbar, empfohlen für Klasse 6 bis 8., Dauer: 4 Schulstunden.
Daten verraten

Sind denn alle verrückt hier?
Verschwörungstheorien erkennen
Kostenlos nutzbar, empfohlen ab der 6. Klasse, Dauer: zwei bis drei Schulstunden.
Verschwörungstheorien
Linksammlung
Weiterführende Informationen
Letzte Aktualisierung: 2022, Internetredaktion der LpB BW.






