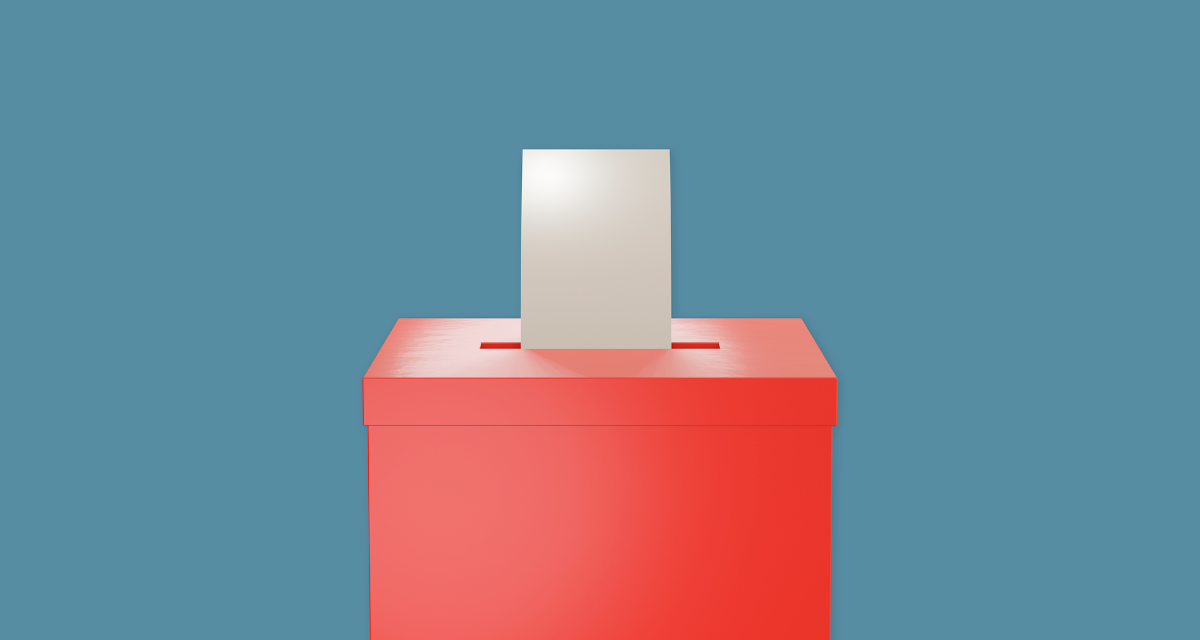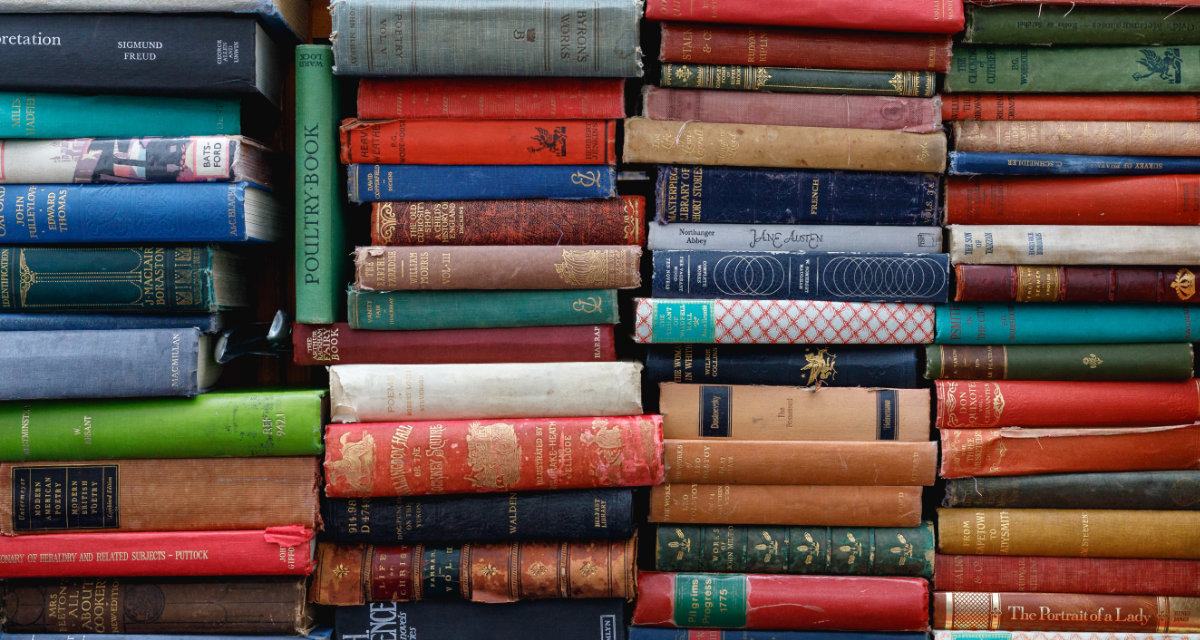Dossier
Menschenrechtsdeklarationen und weltumspannende Abkommen
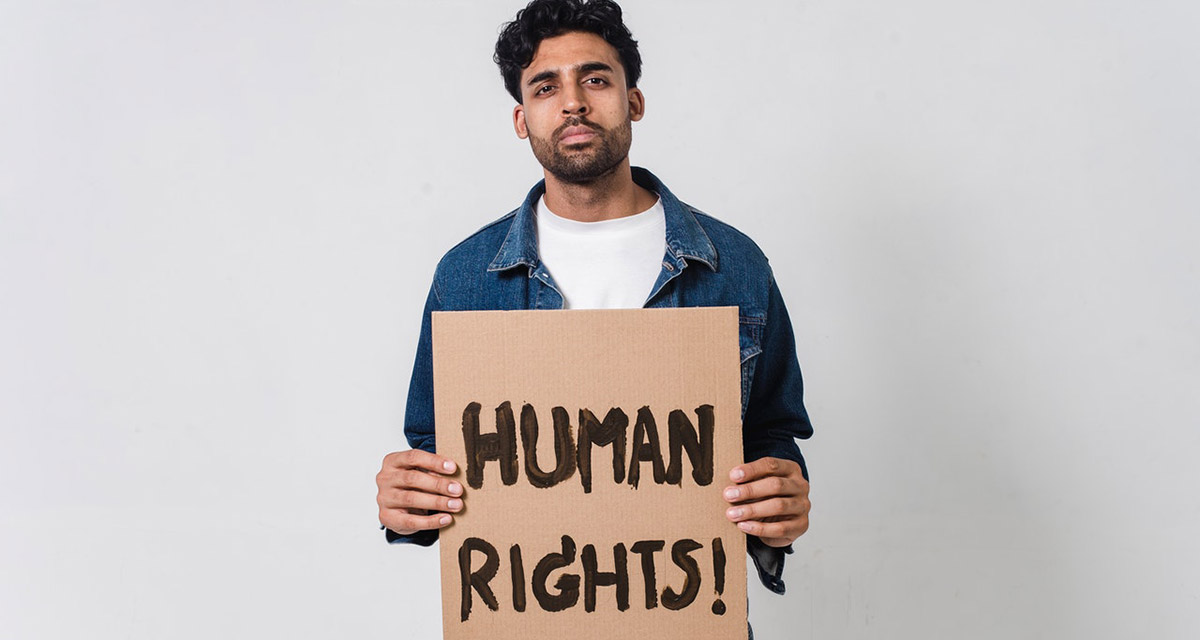
Obwohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nur den Charakter einer Empfehlung besaß, sind ihre Auswirkungen heute noch deutlich zu spüren. Viele globale und regionale Konventionen sowie völkerrechtliche Verträge berufen sich auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Zahlreiche Verfassungen entstanden unter ihrem Einfluss, beispielsweise auch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, das damit nur eines von vielen Beispielen für die Reichweite der hier vorgestellten Menschenrechtsdeklarationen und Menschenrechtsabkommen ist.
Übersicht: Grundlegende UN-Menschenrechtsabkommen
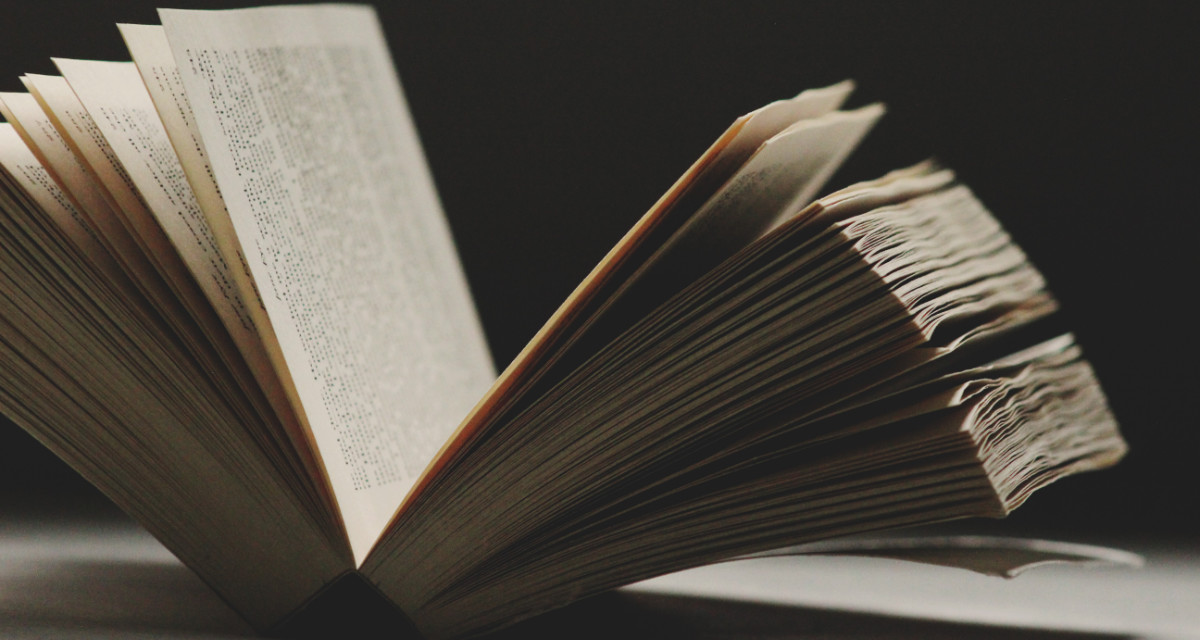
Die Grundlage einer umfassenden Gesetzessammlung der Vereinten Nationen, die zum ersten Mal in der Geschichte einen universellen und international geschützten Code an Menschenrechten bietet, ist die Charta der Vereinten Nationen (1945) und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948). Seitdem wurde der Menschenrechtskatalog der Vereinten Nationen schrittweise erweitert. Dabei wurden spezifische Standards für Frauen, Behinderte, Minderheiten, Wanderarbeitnehmer:innen und andere Gruppen eingeführt.
Grundlegende Menschenrechtsabkommen | verabschiedet / in Kraft | Anzahl der Ratifikationen (Stand Dez. 2022) |
|---|---|---|
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (mehr) | 1966/1976 | 171 |
Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (mehr) | 1966/1976 | 173 |
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung | 1966/1969 | 182 |
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau | 1979/1981 | 189 |
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe | 1984/1987 | 173 |
Übereinkommen über die Rechte des Kindes | 1989/1990 | 196 |
Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien | 1990/2003 | 58 |
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung | 2006/2008 | 186 |
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen | 2006/2010 | 70 |
Quelle: United Nations Treaty Collection
1945: Charta der Vereinten Nationen
Die Charta der Vereinten Nationen ist eine Art Verfassung der UN und wurde am 26. Juni 1945 durch ihre fünfzig Gründungsmitglieder in San Francisco unterzeichnet. In Kraft trat die Charta am 24. Oktober 1945. Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag und damit für Länder, die sie ratifiziert haben, rechtlich verbindlich. Die Charta besteht aus einer Präambel und 19 Kapiteln, in denen ihre Grundsätze, die Mitgliedschaft, die Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen, regionale Abmachungen, die internationale Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, die Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung und die Aufgaben und Befugnisse der Hauptorgane der UNO näher bestimmt sind.
Ziel der Charta ist es,
- den Frieden und
- die Sicherheit in der Welt zu bewahren
- sowie die friedliche Beilegung von Streitigkeiten zu garantieren.
Auch die Grundrechte und die Würde des Menschen werden in der Charta festgehalten. Außerdem will die UN Bedingungen schaffen, unter denen Gerechtigkeit gewahrt werden kann. Der Internationale Gerichtshof als Rechtsprechungsorgan ist ebenso in der Charta festgehalten.
Problematisch und umstritten ist jedoch Artikel 2, Ziffer 7 der Charta, in dem es heißt: „Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, oder eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegenheiten einer Regelung auf Grund dieser Charta zu unterwerfen, nicht abgeleitet werden.“
Aus diesem Artikel kann ein Konflikt zwischen Menschenrechtsverletzungen und dem Selbstbestimmungsrecht der Völker abgeleitet werden. Demnach hätte die UNO laut ihrer eigenen Charta selbst bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen innerhalb eines Staates nicht die Aufgabe, einzugreifen.
Charta der Vereinten Nationen im Wortlaut
1945: Statut des Internationalen Gerichtshofs
Der Internationale Gerichtshof (IGH) ist das „Hauptrechtssprechungsorgan” der Vereinten Nationen (Art. 92 der UN-Charta). Er hat seinen Sitz in Den Haag (Niederlande). Der IGH wurde 1945 gegründet und setzt sich aus 15 unabhängigen Richterinnen und Richtern zusammen, die 15 verschiedenen Staaten angehören müssen und somit die wichtigsten Kulturkreise und Rechtssysteme der Welt vertreten. Alle drei Jahre wird je ein Drittel der Mitglieder des IGH von der UN-Vollversammlung und dem UN-Sicherheitsrat auf neun Jahre gewählt.
Der IGH hat zum einen die Aufgabe, internationale Streitfälle zu regeln und beizulegen. Er kann von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen angerufen werden; andere Staaten können dort ebenfalls klagen oder verklagt werden, wenn sie entweder dem Statut des IGH beigetreten sind oder sich im Einzelfall der Entscheidung des IGH unterstellen. Zum anderen muss der IGH für die Vereinten Nationen und deren Sonderorganisationen Rechtsgutachten zu völkerrechtlichen Fragen erstellen.
Statut des Internationalen Gerichtshofs im Wortlaut
Kennen Sie Ihre Menschenrechte?
1948: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung im Pariser Palais de Chaillot angenommen. Die Erklärung gilt als Basis der modernen Menschenrechtsgesetzgebung und wird in der internationalen Staatengemeinschaft ohne Ausnahme anerkannt.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
1949: Genfer Konvention
zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten
Die Genfer Konvention vom 12. August 1949 ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die Minderung von menschlichem Leiden bei bewaffneten Konflikten und Kriegen sowie insgesamt die Mäßigung der Kriegsführung zum Ziel hat. Bis heute wurde die Genfer Konvention von 196 Staaten unterzeichnet.
Die Genfer Konvention besteht aus insgesamt vier Abkommen, die detailliert den Status und die Rechte von Kombattanten, Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung regeln.
- Eine erste Konvention („Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde“) erarbeitete 1864 das Internationale Rote Kreuz. Die Initiative dazu kam von Henri Dunant, einem Schweizer Geschäftsmann, der 1859 nach Norditalien gereist und dabei Zeuge der blutigen Schlacht von Solferino geworden war. Er gründete daraufhin die Rot-Kreuz-Organisation.
- 1907 wurde die zweite Genfer Konvention („Genfer Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See“) unterschrieben.
- 1929 entstand die dritte Konvention („Genfer Abkommen zur Behandlung von Kriegsgefangenen“).
- Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1949, kam das vierte Abkommen („Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten“) dazu. 1977 wurde das Genfer Abkommen um zwei Zusatzprotokolle ergänzt.
Diese Kontrolle über die Einhaltung des Abkommens übernimmt das Internationale Komitee des Roten Kreuzes und die Staatengemeinschaft. Bilder aus dem US-amerikanischen Gefangenenlager Guantanamo (seit 2002), der Völkermord in Ruanda (1994) und im Sudan (seit 2003), die Misshandlungen von irakischen Gefangenen im Bagdader Gefängnis Abu Ghraib (2003/04) oder der Völkermord an den Jesiden (seit 2014) beweisen jedoch, dass Staaten und kriegstreibende Gruppen immer wieder gegen die Grundprinzipien der Genfer Konvention verstoßen und es eine Herausforderung bleibt, die Rechte der geschützten Personen durchzusetzen.
Weitere Infos zum Genfer Abkommen auf der Seite des Deutschen Roten Kreuzes
1966: Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt)
Damit die Menschenrechte rechtsverbindlich werden konnten, verabschiedeten die Vereinten Nationen 1966 zwei Menschenrechtspakte, die 1976 in Kraft traten und die den Menschenrechten eine rechtliche Form gaben. Gemeinsam mit der Allgemeinen Erklärung bilden der UN-Zivilpakt und der UN-Sozialpakt den internationalen Menschenrechtskodex.
Der UN-Zivilpakt beinhaltet:
- Diskriminierungsverbot
- Recht auf Leben
- Verbot der Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
- Verbot der Sklaverei, Leibeigenschaft, Zwangsarbeit
- Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit
- Recht auf Freizügigkeit
- Gleichheit vor dem Gesetz, Unschuldsvermutung, faires Gerichtsverfahren, verfahrensrechtliche Mindestgarantien, Doppelstrafverbot
- Rückwirkungsverbot
- Anerkennung als Rechtsperson
- Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre
- Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
- Recht auf unbehinderte Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung
- Recht auf Versammlungsfreiheit
- Recht auf Vereinigungsfreiheit
- Recht auf Heirat und Familiengründung; Schutz der Familie
- Rechte von Kindern auf Schutz
- Recht von Staatsbürger:innen auf Mitwirkung an der Gestaltung öffentlicher Angelegenheiten, auf freie Wahlen und auf Zugang zu öffentlichen Ämtern
1966: Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt)
Der UN-Sozialpakt beinhaltet:
- Diskriminierungsverbot;
- Recht auf Arbeit, Recht auf gerechte und günstige Arbeitsbedingungen (angemessener Lohn, gleiches Entgelt für gleiche Arbeit, sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, Arbeitspausen, angemessene Begrenzung der Arbeitszeit, bezahlter Urlaub, Vergütung gesetzlicher Feiertage);
- Recht auf Gründung und Betätigung von Gewerkschaften;
- Recht auf soziale Sicherheit (Sozialversicherung);
- Schutz von Familien (Gründung, Erziehung), Müttern (Mutterschaftsurlaub) und Kindern (vor wirtschaftlicher und sozialer Ausbeutung);
- Recht auf angemessenen Lebensstandard (ausreichende Nahrung, Bekleidung, Unterkunftund Wasser*) und Recht auf Schutz vor Hunger;
- Recht auf erreichbares Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit;
- Recht auf Bildung (Grundschulpflicht, offener Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen);
- Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben und auf Teilhabe an den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts sowie Schutz geistiger Urheberrechte.
* Das Recht auf Wasser ist nicht explizit erwähnt, wird aber im Wesentlichen aus dem Recht auf angemessenen Lebensstandard und dem Recht auf Gesundheit hergeleitet. Es wurde später durch UN-Resolutionen bekräftigt.
Entwickeln sich die Menschenrechte weiter?

Als Ergebnis historischer Prozesse unterliegen die völkerrechtlich verankerten Menschenrechte auch weiterhin einem Wandel. Selbst wenn die „Normsetzung” weit vorangeschritten ist, kann der „Katalog” der Menschenrechte verändert und erweitert werden. In den vergangenen Jahrzehnten wurden zahlreiche Menschenrechtsabkommen erarbeitet, welche die in der AEMR postulierten Rechte ausdifferenzierten und auf besondere Bevölkerungsgruppen und menschenrechtliche Probleme hin konkretisierten. Zu weiteren Abkommen
Prinzipiell ist anzunehmen, dass neue Unrechtserfahrungen und künftige Veränderungen in den menschlichen Lebensbedingungen und Sozialbeziehungen (etwa im Bereich der Gentechnik, der digitalen Kommunikation oder der Klimakrise), verbunden mit der Kritik an Unzulänglichkeiten des bestehenden Menschenrechtsschutzes, auch weiterhin neue Menschenrechte hervorbringen können. Zugleich sind die Menschenrechtsabkommen „living instruments”. Die Interpretation der bereits bestehenden Menschenrechte ist also nicht starr.
Viele völkerrechtliche und politische Debatten kreisen gegenwärtig jedoch weniger um die Festschreibung neuer Menschenrechte als vielmehr um eine zeitgemäße Auslegung bestehender Rechte. Auch das Verständnis davon, wer Träger der Menschenrechte ist und wen die Menschenrechte auf welche Weise verpflichten, ist Veränderungen unterworfen. Die historische Entwicklungsoffenheit der Menschenrechte bedeutet allerdings nicht Beliebigkeit: Die Festschreibung neuer und die Neuinterpretation bestehender Menschenrechte sind zwar notwendig, um neuen Gegebenheiten und Problemen Rechnung tragen zu können (wer hätte 1948 etwa bereits an die Gefahr einer weltweiten Datenüberwachung denken können), doch sind sie stets dahingehend zu prüfen, ob sie sich inhaltlich-systematisch in das Gefüge des Menschenrechtsschutzes einbetten.
Aus: Politik & Unterricht, Heft 3/4–2014. Zum Download
Quellen und weitere Informationen
Quellen und weitere Informationen
- Auswärtiges Amt: ABC der Vereinten Nationen
- Deutsches Rotes Kreuz: 150 Jahre Genfer Abkommen
- Verein Humanrights.ch: Regionale Menschenrechtsabkommen
Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Dezember 2022.