Dossier
Weltklimagipfel
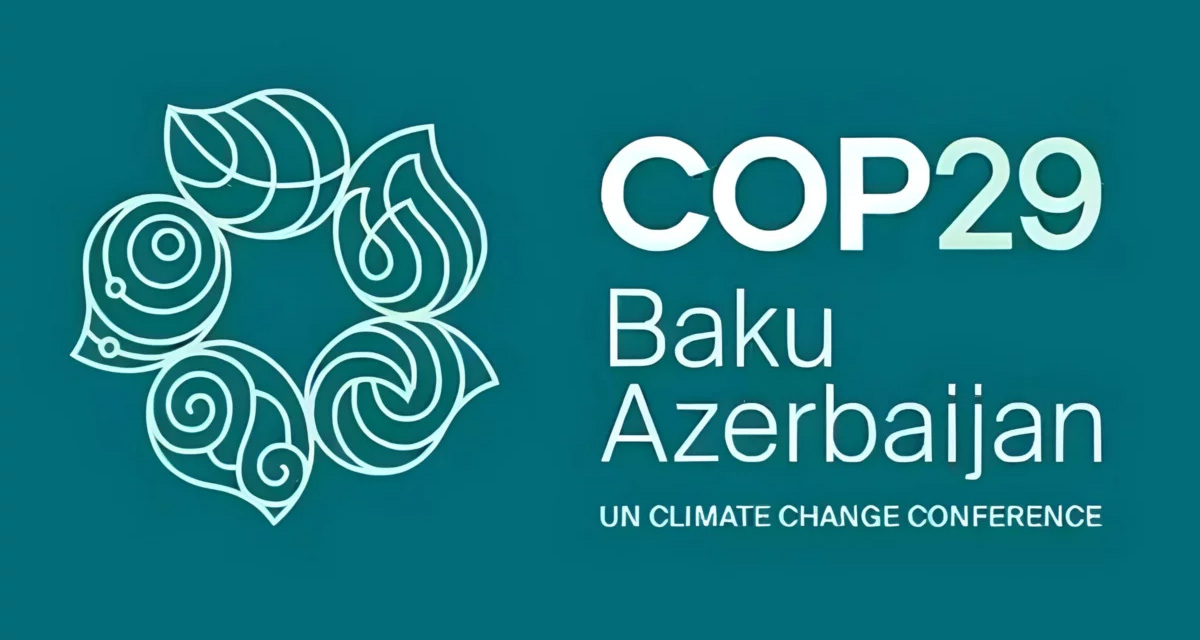
Jährlich treffen sich die 197 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur UN-Klimakonferenz, um sich auf gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu verständigen. Vom 11. November bis 22. November 2024 fandt der Weltklimagipfel in Baku in Aserbaidschan statt. Unser Dossier bietet Infos zum aktuellen Gipfel sowie Hintergründe über die Klimakonferenzen der vergangenen Jahre.
Was ist der Weltklimagipfel?

Der Weltklimagipfel der Vereinten Nationen, auch UN-Klimakonferenz genannt, ist eine jährlich stattfindende Konferenz derjenigen Staaten, die die UN-Klimarahmenkonvention von 1992, das Kyoto-Protokoll von 1997 und das Pariser Klimaabkommen von 2015 beschlossen haben. Der erste Weltklimagipfel (COP-1) fand 1995 in Berlin statt.
Aktuell sind das 196 Staaten und die Europäische Union.
COP ist die Abkürzung für „Conference of the Parties“, zu deutsch: Vertragsstaatenkonferenz.
UN-Klimakonferenz 2025
COP 30
Die 30. Weltklimakonferenz 2025 soll in Brasilien in Belém stattfinden.
29. UN-Klimakonferenz (11. November bis 22. November 2024 in Baku)
Die 29. Weltklimakonferenz fand vom 11. bis 22. November in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, statt. Auch in diesem Jahr war wie 2023, mit Aserbaidschan ein autoritärer und erdölproduzierender Staat Gastgeber der diesjährigen UN-Klimakonferenz.
40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich für die Konferenz registriert. Neben Staats- und Regierungschefinnen und -chefs waren Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen, der Wissenschaft, der Industrie und Energiewirtschaft sowie Journalistinnen und Journalisten angereist. Wie immer gestalteten sich die Verhandlungen wieder sehr schwierig und wären fast gescheitert. Erst nach einer Verlängerung von 30 Stunden konnte ein umstrittene Einigung erzielt werden.
In Baku stand das Thema Klimafinanzierung im Vordergrund. Bisher galt die Abmachung, dass die reicheren Staaten 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Entwicklungsländer bereitstellen. Dieses Ziel wurde 2023 zum ersten Mal erreicht. Da diese Verabredung 2025 ausläuft, wurde in Baku über ein neues Finanzziel verhandelt.
Die Teilnehmerstaaten konnten sich als ein zentrales Ergebniss des Gipfels darauf verständigen, die Finanzhilfen für Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen der Erderwärmung aufzustocken. Als Gesamtziel wurde festgehalten, dass die Klimafinanzierung für Entwicklungsländer bis 2035 1,3 Billionen US-Dollar pro Jahr aus öffentlichen und privaten Quellen betragen soll. Statt der vormaligen 100 Milliarden Dollar – sollen bis zum Jahr 2035 nun nur ein kleiner Teil von mindestens 300 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2035 als Klimahilfen an Entwicklungsländer fließen, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Dafür aufkommen sollen weitgehend die Industrienationen.
Die Summe gilt vielen Klimaschutzorganisationen und einer Vielzahl an Staaten des globalen Südens als viel zu gering, besonders vor ihren Forderungen von 1,3 Billionen jährlich bis zum Jahr 2035. Doch nicht nur dieses Ergebniss stieß auf Kritik. Die Staatengemeinschaft konnte sich in ihrem Abschlussdokument auch auf keine neuen Schritte für eine weitere CO2-Reduzierung einigen.
COP 29: Quellen und Links
Offizielle Webseite der COP 29 (Azerbaijan, en)
- UN-Klimakonferenz in Baku 2024 (Wikipedia, de)
- United Nation Climate Change Conference Baku 2024 ( + COP 29 Media Bulletin Note Nr. 1, Download, en)
- EU setzt sich Ziele für die Weltklimakonferenz (Tagesschau, Bericht 15.10.24)
Ergebnisse der COP 29
- GlobalHealth Hub Germany: Ergebnisse der Weltklimakonferenz 2024
- zdf heute.de: Klimakonferenz erzielt Einigung, viele Fragen offen
- tagesschau.de: Kritik und Enttäuschung zum Ende der Weltklimakonferenz
- Deutschlandfunk: Das wurde auf der Klimakonferenz in Baku beschlossen
- WWF Deutschland: Ergebnisse der COP 29
28. UN-Klimakonferenz vom 30. November bis 13. Dezember 2023 in Dubai
28. UN-Klimakonferenz vom 30. November bis 13. Dezember 2023 in Dubai

Vom 30. November bis 13. Dezember 2023 hat die 28. UN-Klimakonferenz in Dubai stattgefunden, eines von sieben Emiraten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Vertreter aus 197 Staaten haben zwei Wochen lang über Umwelt- und Klimaschutz diskutiert. Schließlich konnten sie sich nach langen Debatten auf eine Abschlusserklärung einigen.
Das steht in der Abschlusserklärung: Die Ergebnisse im Überblick
- Abkehr von fossilen Energien: In dem Beschluss hat sich die Weltgemeinschaft auf einen Abschied von Kohle, Öl und Gas geeinigt, zumindest auf dem Papier. Ein Bekenntnis zu einem „klaren Ausstieg“ kommt in dem Dokument aber nicht vor.
- Umstieg auf erneuerbare Energien: Die Kapazitäten erneuerbarer Energien sollen bis zum Jahr 2030 verdreifacht und die Energieeffizienz soll verdoppelt werden, heißt es im Abschlussdokument.
- Entschädigungsfonds für ärmere Länder: Staaten des Globalen Südens können zukünftig mit Unterstützung rechnen, wenn sie von Klimaschäden wie Fluten, Dürren und Stürme getroffen werden. Mehrere Staaten sicherten Gelder zu. Deutschland beteiligt sich bei den Fonds mit 100 Millionen, ebenso wie der Gastgeber die Vereinigten Arabischen Emirate. Insgesamt kamen etwa 800 Millionen US-Dollar zusammen.
Diskussionen
- Wegen des Streits über den Ausstieg aus fossilen Energieträgern hatte die Konferenz länger als geplant gedauert. Viele Staaten und die EU hatten sich für den Ausstieg ausgesprochen, die Ölförderländer dagegen. Der Kompromiss: Man einigte sich im Abschlussdokument auf „Abkehr“ statt „Ausstieg“.
- Diskussionen gab es auch über die Verfahren zur Co2-Reduzierung und über das Ernährungssystem, das viele Treibhausgase verursacht.
Reaktionen
Viele Staats- und Regierungschefs äußerten sich zufrieden, etwa die EU. Die Bundesregierung stellte sich ausdrücklich hinter den Beschluss, wie die Tagesschau berichtet. Auch Umweltverbände und Entwicklungsorganisationen bewerten die Beschlüsse der Weltklimakonferenz überwiegend positiv, kritisierten den Beschluss aber als nicht ausreichend.
Kritik gab es an dem fehlenden Bekenntnis zum „klaren Ausstieg“ bei Kohle, Öl und Gas und an der mangelnden Unterstützung für die ärmeren Staaten. Die bislang gemachten Zusagen zum Pariser Klimaabkommen würden nicht ausreichen, um die globale Erhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken, so der Vorwurf.
Den Vorsitz der Konferenz hatte der Minister für Industrie und Fortschrittstechnologien in den VAE und Chief Executive Officer (CEO) der VAE-Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan Ahmed al-Dschaber, inne. Diese Personalie und die damit verbundene Verquickung von wirtschaftlichen Interessen des Ölunternehmens und politischen Interessen der Klimakonferenz wurde bereits von Klimaaktivist:innen und Medien kritisiert, zum Beispiel von ZEIT online.
Auf der offiziellen Webseite hieß es im Vorfeld der Konferenz:
Wir befinden uns auf halbem Weg. Seit Paris sind 7 Jahre vergangen, und bis 2030 sind es noch 7 Jahre. Wir müssen auf die Fakten reagieren. Wir müssen die Emissionen bis 2030 um 43 % senken und eine Kurskorrektur in Bezug auf Anpassung, Finanzierung sowie Verlust und Schäden vornehmen. Wir werden eine transformative COP der Maßnahmen durchführen. Eine COP für alle.“
27. UN-Weltklimagipfel vom 6. bis 20. November 2022 im ägyptischen Sharm el-Sheik
27. UN-Weltklimagipfel vom 6. bis 20. November 2022 im ägyptischen Sharm el-Sheik

Am 6. November 2022 begann die UN-Klimakonferenz (COP 27) im ägyptischen Sharm el-Sheik. Rund 40.000 Teilnehmende aus fast 200 Ländern rangen über zwei Wochen lang um Lösungen und konkrete Vereinbarungen im Kampf gegen den Klimawandel. Über 100 Staats- und Regierungschefs reisten nach Ägypten, um der Dringlichkeit des Themas Gewicht zu verleihen.
Bei der COP 27 ging es vor allem um finanzielle Fragen und striktere Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen, um das 1,5-Grad-Ziel doch noch zu erreichen. Aktuell hat sich die Erde bereits um 1,1 Grad erwärmt.
Die Agenda war also konfliktträchtig, weshalb die Erwartungen vieler Expert:innen schon im Vorfeld des Weltklimagipfels gedämpft waren. Am Ende wurde die Konferenz zwar um rund 36 Stunden verlängert und man einigte sich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung. Doch die Enttäuschung über die wenig ambitionierten Ergebnisse ist groß. Das Motto des Weltklimagipfels – „Together for just, ambitious implementation NOW“ („Gemeinsam für eine gerechte, ambitionierte Umsetzung JETZT“) – wurde nicht erfüllt.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Aufbau eines gemeinsamen Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern: Es werden gemeinsame Finanzierungsmechanismen geschaffen, um Länder, die von Klimakatastrophen wie Überschwemmungen und Dürren besonders betroffen sind, im Schadensfall schnell zu helfen. Diese Einigung wird allgemein als „historischer Durchbruch“ und „Meilenstein“ gefeiert. Nun soll im nächsten Schritt eine Kommission Empfehlungen zum Aufbau des Fonds erarbeiten, die sie auf der nächsten Konferenz Ende 2023 in Dubai präsentieren wird. Wer einzahlen soll und um welche Summen es geht, steht bisher nicht fest.
- Im Abschlusspapier ist der weltweite Ausstieg aus der Kohleförderung und -verbrennung festgehalten.
Kritik am Ergebnis:
- Eine Abkehr von der Nutzung von Öl und Gas wurde mit keinem Wort erwähnt. Hier konnten sich die öl- und gasfördernden Länder, vor allem der Golfregion, gegen Klimaaktivist:innen durchsetzen.
- Striktere Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen konnten nicht vereinbart werden. Es gab sogar Bestrebungen einzelner Länder, die Vereinbarungen, die im Vorjahr in Glasgow getroffen worden waren, wieder zurückzuschrauben. Bisher wird angestrebt, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 43 Prozent im Vergleich zu 2019 zu senken und etwa 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Doch viele Länder haben zwar Klimaschutzziele verabschiedet, doch an der konkreten Umsetzung hapert es gewaltig. Bis zur COP 28 sollen die Staaten ihre nationalen Ziele bis 2030 nachbessern. Doch eine Verpflichtung zur Nachbesserung gibt es nicht, sondern erfolgt auf freiwilliger Basis.
- Der Ausbau erneuerbarer Energien findet sich nicht als konkrete Forderung im Text, sondern nur die unkonkrete Formulierung „sauberer Energiemix“.
Quellen: tagesschau.de, Spiegel online
26. UN-Weltklimagipfel vom 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow
26. UN-Weltklimagipfel vom 31. Oktober bis 12. November 2021 in Glasgow

Die eigentlich für November 2020 im schottischen Glasgow geplante UN-Klimakonferenz (COP 26) wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und fand vom 31. Oktober bis 13. November 2021 statt. Gastgeber war das Vereinigte Königreich in Kooperation mit Italien. Die Konferenz stand unter dem Motto „Die Welt vereinen, um den Klimawandel zu bekämpfen“. 120 Staats- und Regierungschefs und 25.000 Teilnehmende reisten nach Glasgow.
196 Nationen und die Europäische Union diskutierten und verhandelten beim 26. Weltklimagipfel über den aktuellen Stand des Pariser Klimaschutzabkommens von 2016 und einigten sich am 13. November 2021 auf eine gemeinsame Abschlusserklärung. Größere und schnellere Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel und mehr Solidarität mit den heute schon am schwersten vom Klimawandel betroffenen Ländern seien vonnöten, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu erreichen, so das Fazit der Staatengemeinschaft.
Die wichtigsten Ergebnisse
1,5-Grad-Ziel
Die Staatengemeinschaft hat sich in Glasgow auf das 1,5-Grad-Ziel als strengere Zielmarke verständigt. Im Pariser Klimaschutzabkommen war noch die Rede davon, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.
Globale Energiewende
Erstmals hat man sich auf einer COP auf einen Abbau der Kohlegewinnung und die Streichung von „ineffizienten“ Subventionen für fossile Energien geeinigt. Klimaschützer:innen kritisieren jedoch, dass die entsprechende Erklärungauf Drängen Chinas und Indien abgeschwächt wurde. So ist nicht mehr konkret von einem Ausstieg die Rede, sondern die Erklärung ruft lediglich dazu auf, die Nutzung von Kohlekraftwerken „schrittweise zu verringern“.
Nachbesserung bei Klimazielen
Dem Glasgower Beschluss zufolge sollen Treibhausgasemissionen bis 2030 weltweit um 45 Prozent im Vergleich zu 2010 verringert werden – die Weltgemeinschaft hält fest, dass ansonsten das 1,5-Grad-Ziel nicht zu erreichen sei. Die Staaten sollen daher ihre nationalen Klimaschutzziele (NDC - nationaly determined contributions) bis 2030 bereits bis Ende 2022 nachbessern, nicht erst bis 2025. Künftig soll nicht nur alle fünf Jahre, sondern jährlich überprüft werden, wie groß die Lücke zum 1,5-Grad-Ziel ist.
Einheitliches Regelwerk
Um Klimaziele besser überprüfen und vergleichen zu können, gelten künftig einheitliche Standards. Außerdem soll im Fünfjahresrhythmus berichtet und neue Klimaziele für fünf Jahre festgelegt werden. Der Zehnjahresrhythmus ist obsolet. Dies ist aber nicht verpflichtend, sondern es wird lediglich dazu „ermutigt“.
Klimafinanzierung für ärmere Länder
Es gibt weiterhin keine generelle Verpflichtung, in welcher Form und in welcher Höhe die Industrieländer ärmere Länder beim Kampf gegen den Klimawandel unterstützen. Dies gilt sowohl für Finanzhilfen, die in Klimaschutzprojekte fließen, als auch für Anpassungshilfen an die Folgen des Klimawandels.
Ein Versprechen der Industrieländer aus dem Jahr 2009, bis 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an Klimahilfen bereitzustellen, haben die Industrienationen nicht eingehalten. Voraussichtlich wird diese Summe erst ab 2023 erreicht. Fehlbeträge der vergangenen Jahre müssen die Industrieländer nicht ausgleichen. Welche Gelder ab 2026 an fließen sollen, soll in einem mehrjährigen Prozess festgelegt werden. Deutschland will seine Klimaschutzhilfen bis spätestens 2025 auf sechs Milliarden Euro jährlich erhöhen, 2020 waren es fünf Milliarden Euro.
Aktuell gehen rund 80 Milliarden Dollar an Klimahilfen pro Jahr an Entwicklungsländer vor allem in Afrika und Asien. Diese 46 Staaten, in denen eine Milliarde Menschen leben, sind von den Folgen des Klimawandels schon heute besonders stark betroffen, jedoch nur für ein Prozent der globalen klimaschädlichen Emissionen verantwortlich. Umweltverbände und die Entwicklungsländer kritisieren, dass die Mittel zur Klimafinanzierung zu etwa 70 Prozent aus Krediten und nur zu 30 Prozent aus Zuschüssen bestehen. Hier müssten die Industrienationen mehr Verantwortung übernehmen und für die entstehenden Klimaschäden aufkommen, so die Kritiker:innen. Dem Wunsch vieler Entwicklungsländer, einen eigenständigen institutionellen Finanzrahmen, etwa einen Fonds zu schaffen, wurde nicht nachgekommen.
Ein weiterer Streitpunkt: 80 Prozent der Gelder fließen aktuell in Projekte zum Klimaschutz. Der Rest ist für Vorhaben gedacht, mit denen sich die Länder an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Hier fordern die Entwicklungsländer eine 50-50-Aufteilung. In Glasgow wurde nun zumindest anerkannt, dass die Kosten für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels steigen. Die Staaten wurden dazu aufgefordert, ihre Anpassungshilfen für ärmere Länder bis 2025 zu verdoppeln.
Handel mit Emissionszertifikaten
Hier wurden einige Schlupflöcher geschlossen, damit Klimaschutzleistungen nicht doppelt angerechnet werden können. Klimaschützer:innen hätten sich jedoch einen klareren Rahmen gewünscht.
Weitere Initiativen
Reduktion des Methanausstoßes
Bis 2030 soll der weltweite Ausstoß von Methan um 30 Prozent reduziert werden. 105 Staaten schlossen sich auf dem Weltklimagipfel in Glasgow einer entsprechenden Initiative der USA und der Europäischen Union an. Methan ist das zweitschädlichste Treibhausgas und verantwortlich für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung. Laut EU-Kommission könnte bei Einhaltung dieser Zielmarke die Klimaerwärmung bis 2050 um 0,2 Grad reduziert werden.
Stopp von Entwaldung
141 Staaten haben sich in Glasgow verpflichtet, die Zerstörung von Wäldern und anderen Landschaften bis 2030 zu stoppen. Noch immer wird täglich pro Minute eine Fläche von rund 27 Fußballfeldern abgeholzt oder geht auf anderem Wege verloren. Die beteiligten Länder, darunter Deutschland und die gesamte EU, vereinen 90 Prozent der weltweiten Waldfläche auf ihren Staatsflächen, also etwa 34 Millionen Quadratkilometer. Mit dabei sind die Staaten mit den größten Wäldern überhaupt, also Kanada, Russland, Brasilien, Kolumbien, Indonesien sowie China, Norwegen und die Demokratische Republik Kongo.
Links
- Webseite der COP 26: 26. Weltklimakonferenz in Glasgow
- BMU: COP26-UN-Klimakonferenz
- Bundesregierung: Zusammenfassung der Beschlüsse der 26. UN-Klimakonferenz
- BpB: UN-Klimakonferenz in Glasgow
- ZDF heute: Die wichtigsten Ergebnisse der Klimakonferenz
25. UN-Weltklimagipfel vom 2. bis 13. Dezember 2019 in Madrid
25. UN-Weltklimagipfel vom 2. bis 13. Dezember 2019 in Madrid

Vom 2. bis 13. Dezember 2019 fand die bisher letzte UN-Klimakonferenz (COP 25) in der spanischen Hauptstadt Madrid unter der Präsidentschaft Chiles statt. Eigentlich hätte die chilenische Hauptstadt Santiago de Chile Veranstaltungsort sein sollen, die Konferenz wurde jedoch kurzfristig nach Madrid verlegt. Im Mittelpunkt der Konferenz stand neben den letzten Detailregelungen für die Umsetzung des Übereinkommens von Paris die Frage, wie die Klimaschutz-Anstrengungen der Länder erhöht werden können. Das Motto der COP 25 lautete „Es Tiempo de Actuar“ — auf Deutsch „Zeit zu Handeln“.
In der ersten Woche waren bei den zwischenstaatlichen Verhandlungen vor allem die Expert:innen unter sich, in der zweiten Woche griffen auch etliche Minister:innen und Regierungschefs ins Geschehen ein.
Zunächst ging es bei dieser Konferenz um die nationalen Klimaschutzpläne, in denen jedes Land festlegt, wie schnell und in welchem Umfang es seinen Treibhausgas-Ausstoß reduzieren will. Das zweite Thema waren die Regeln zum Handel mit CO2-Emissionszertifikaten: Das Pariser Abkommen sieht die Möglichkeit vor, dass Staaten mit geringeren Emissionen Verschmutzungsrechte an Staaten mit einem höheren CO2-Ausstoß verkaufen können. Beim dritten Thema ging es um die Frage, wie reiche Länder ärmere Staaten unterstützen können, die schon heute unter der Klimaerwärmung leiden. Bisher gibt es keinen Mechanismus, um Ländern in solchen Fällen zu helfen.
Die Klimakonferenz endete am 15. Dezember trotz Verlängerung nur mit einem Minimal-Kompromiss. Zum Schluss ging es in Madrid nur noch um Schadensbegrenzung. Das Plenum erinnerte alle Staaten an ihre Zusage, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen. Beim Handel mit Klimazertifikaten gabe es keine Einigung — ein Beschluss wurde auf den nächsten Gipfel in Glasgow verschoben. Weiterhin strittig sind zudem Fragen rund um Finanzhilfen der reicheren Länder für die ärmeren. Die Hoffnung von Entwicklungsländern und Inselstaaten auf einen eigenen internationalen Fonds zur Bewältigung von bereits eintretenden klimabedingten Schäden und Verlusten, so etwa durch Stürme, Dürren, Starkregen oder steigende Meeresspiegel, erfüllte sich nicht.
24. UN-Weltklimagipfel vom 2. bis 14. Dezember 2018 in Katowice
24. UN-Weltklimagipfel vom 2. bis 14. Dezember 2018 in Katowice

Die 24. Weltklimakonferenz (Conference of the Parties, COP) hat vom 2. bis 14. Dezember 2018 im polnischen Katowice stattgefunden. Nach 2008 (Posen) und 2013 (Warschau) richtete Polen zum dritten Mal die Weltklimakonferenz aus.
Die Konferenz war die wichtigste seit der COP21 im Jahr 2015, bei der das Klimaabkommen von Paris verabschiedet wurde. Im Mittelpunkt standen zwei Themen:
- Es sollten erstens die Umsetzungsregeln für das Übereinkommen verabschiedet werden. Nachdem in Paris beschlossen wurde, welche Ziele sich die Staatengemeinschaft setzt und welche Verpflichtungen die Staaten haben, war jetzt zu entscheiden, wie die Verpflichtungen umgesetzt werden sollen. Die Beiträge der einzelnen Staaten zum Klimaschutz und auch die Finanzhilfen sollten für alle nachvollziehbar werden.
- Zweitens berieten die Staaten im Rahmen des Talanoa Dialogs, wie die Klimaziele weltweit verbessert werden können. Von diesem Dialog sollte ein starkes Signal für bessere national bestimmte Beiträge (NDCs) im Jahr 2020 ausgehen.
Im Rahmenprogramm der Verhandlungen hatten Vertreter:innen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft gezeigt, dass es eine wachsende weltweite Bewegung für mehr Klimaschutz gibt, die weit über die klassische Umwelt-Community hinausgeht.
Zum offiziellen Auftakt der Weltklimakonferenz hatte UN-Generalsekretär António Guterres am 3. Dezember 2018 in einem dramatischen Appell die 200 Teilnehmerstaaten zu einem entschlossenen Kampf gegen die Erderwärmung aufgefordert. Weltweit sei der Klimawandel für viele Menschen, Regionen und auch ganze Staaten bereits eine „Frage von Leben und Tod“, sagte er in Katowice. Die „verheerenden Folgen“ des globalen Temperaturanstiegs seien überall sichtbar geworden. Wenn die Welt versagt, werden die Arktis und Antarktis weiter schmelzen, die Korallen sterben, der Meeresspiegel steigen, mehr Menschen werden an Luftverschmutzung und Wasserknappheit sterben und die Kosten dieses Desasters werden durch die Decke schießen.“
Schon damals war klar, dass mit den bisherigen Zusagen der Staaten das Ziel des Pariser Abkommens nicht erreicht wird, der CO2-Ausstoß hat weiter zugenommen. Schon jenseits der 1,5 Grad Celsius werde der Klimawandel in vielen Regionen der Welt massiv spürbar werden. Aber immer noch halten Expert:innen dies für möglich, beispielsweise der Weltklimarat IPCC in einer neuen Studie. Dafür müssten die Staaten aber wesentlich mehr tun. Wieviel? Deutschland zum Beispiel müsste seinen CO2-Ausstoß um rund 56 Prozent reduzieren. Ohne Abschaltung der Kohlekraftewerke ist das nicht möglich.
Kurz vor dem offiziellen Ende der Klimakonferenz am 14.12.2018 warnten Teilnehmer:innen vor einem Scheitern der Verhandlungen. Rund 90 Entwicklungsländer erklärten gemeinsam, sie seien zutiefst besorgt.
Nach zähen Verhandlungen hat die UN-Klimakonferenz ein umfassendes Regelwerk für die praktische Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gebilligt.
- Es sollen regelmäßig Berichte vorgelegt werden, in denen unter anderem steht, wie sich der Treibhausgas-Ausstoß entwickelt hat und was ein Land für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel geleistet hat.
- Künftig gelten für alle Staaten einheitliche Transparenzregeln und Standards zur CO2-Erfassung. Dadurch sollen die Fortschritte der einzelnen Länder bei der Verfolgung ihrer CO2-Reduktionsziele vergleichbar sein.
23. UN-Weltklimagipfel vom 6. bis 17. November 2017 in Bonn
23. UN-Weltklimagipfel vom 6. bis 17. November 2017 in Bonn
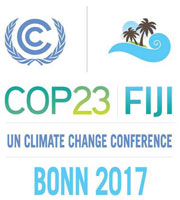
Wie kann das Pariser Klimaschutzabkommen umgesetzt werden? Einer Antwort sind die 195 Staaten auf der Weltklimakonferenz in Bonn ein Stück näher gekommen. Die Staatenvertreter:innen erarbeiteten Entwürfe für die Transparenzregeln und Berichtspflichten, die sich die Länder im Kampf gegen die Erderwärmung geben wollen. Daraus sollte bei der Klimakonferenz Ende 2018 im polnischen Kattowitz das Regelwerk zum Pariser Klimaschutzabkommen entstehen.
Die wichtigsten Ergebnisse:
- Die reichen Länder sagten in Bonn zu, die Umsetzung ihrer finanziellen Versprechen in den kommenden Jahren nochmals zu überprüfen. Verbindliche Finanzzusagen an ärmere Länder lehnten so gut wie alle reichen Länder allerdings ab.
- Ein Fonds, der der Bewältigung der Klimafolgen in armen Ländern dient, soll weiterbestehen. Die Staaten einigten sich darauf, dass der Fonds künftig unter dem Paris-Abkommen verankert sein soll.
- Rund 20 Staaten schlossen sich zu einer Allianz für einen schnellen Kohleausstieg zusammen. Deutschland gehört nicht dazu. Die Mitglieder der Allianz wollen alle herkömmlichen Kohlekraftwerke schrittweise vom Netz nehmen.
- Die weltweiten Klimaschutzbemühungen sollen schon vor dem Jahr 2020 zu untersucht werden. Dafür soll es ab Januar 2018 neben den direkten Verhandlungen den sogenannten Talanoa-Dialog geben. Dieser soll helfen, die noch zu geringen Klimaschutzaktivitäten der Länder zu erhöhen.
- Erstmals wurde ein gemeinsames Arbeitsprogramm zu Landwirtschaft und Klimawandel in die politische Agenda aufgenommen. Es gilt für die nächsten drei Jahre und soll Themen, wie Ernährungssicherheit, Bodenfruchtbarkeit, Anpassung an den Klimawandel behandeln.
- Am Rande der Konferenz starteten Deutschland und die Fidschi-Inseln eine Initiative, mit der rund 400 Millionen Menschen zusätzlich sogenannte Klimarisikoversicherungen erhalten sollen. Die Versicherungen zahlen für Schäden durch Unwetter und Dürren.
- Geklärt werden muss allerdings noch, nach welchen Methoden die Staaten ihren Treibhausgas-Ausstoß erfassen sollen. Konkrete Beschlüsse dazu soll es beim kommenden Gipfel 2018 im polnischen Kattowitz geben.
Der UN-Klimagipfel fand nach 16 Jahren wieder in Bonn statt. 25.000 Vertreter:innen der Staaten, von Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen, aus Wissenschaft und Medien nahmen daran teil. Es war die größte Klimakonferenz, die es bisher in Deutschland gegeben hatte. Dabei hatte Deutschland gar nicht den Vorsitz, sondern der pazifische Inselstaat Fidschi. Weil Fidschi aber eine solch große Konferenz nicht stemmen konnte, übernahm Deutschland die Ausrichtung.
Bundesregierung: Klimakonferenz in Bonn beendet. Wichtige Fortschritte erzielt.
22. UN-Weltklimagipfel vom 7. bis 18. November 2016 in Marrakesch
22. UN-Weltklimagipfel vom 7. bis 18. November 2016 in Marrakesch

Die knapp 200 Teilnehmer:innen der Klimakonferenz in Marokko haben einen Fahrplan aufgestellt, wie das Pariser Klimaschutzabkommen umgesetzt werden soll.
Die Paris-Vereinbarung ist seit dem 4. November 2016 in Kraft. Ihr Ziel: Die Erderwärmung unter zwei Grad zu halten.
Viele Staaten verpflichteten sich nun in Marrakesch, alle Ziele des UN-Klimaabkommens von Paris vollständig umzusetzen. Dabei sollen nicht nur die Regierungen, sondern auch Wissenschaft, Unternehmen und weltweite Aktionen in die Strategie eingebunden werden. Einige Staaten haben dafür schon konkrete Klimaschutzpläne vorgelegt — neben Deutschland auch die USA, Kanada und Mexiko. 100 Milliarden Dollar sollen dabei bis 2022 jährlich an die Entwicklungsländer fließen, um diese beim Kampf gegen die Erderwärmung zu unterstützen.
Die Bundesregierung hatte sich auf einen Klimaschutzplan geeinigt, mit dem der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschland bis zum Jahr 2050 um bis zu 95 Prozent reduziert werden soll.
Außerdem steht ein Bündnis mit dem weltgrößten Klimaverschmutzer China in Aussicht. So hat China klar gemacht, dass es vom Pariser Abkommen nicht abrücken wird. China könnte damit die Lücke füllen, die die USA nach der Trump-Wahl im internationalen Klimaschutz hinterlassen hat.
United Nations: Marrakech Conference
21. UN-Weltklimagipfel vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris
21. UN-Weltklimagipfel vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris

Die Staats- und Regierungschefs von 195 Staaten trafen sich vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in der französischen Hauptstadt Paris, um ein Nachfolgeprotokoll für das 1997 beschlossene Kyoto-Protokoll zu beschließen. Die Konferenz hatte eine besondere Bedeutung, da das Ergebnis das erste internationale und auch völkerrechtlich bindende Abkommen über klimapolitische Maßnahmen ist.
Im Vorfeld des Klimagipfels waren die Teilnahmerstaaten aufgefordert, darzustellen, welchen Beitrag sie individuell leisten wollen, um den Klimawandel zu verlangsamen. Deutschland und die anderen 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben eine gemeinsame Verpflichtungserklärung eingereicht. Darin wird ein ehrgeiziges Ziel formuliert: Die EU-Mitgliedsstaaten wollen den Ausstoß an Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent reduzieren — verglichen mit 1990.
Erster Erfolg auf der Klimakonferenz: Am 5.12.2015 haben sich die Unterhändler:innen der 195 Länder auf einen Entwurf für ein neues Klimaabkommen verständigt. Die Vertreter der 196 Verhandlungspartner akzeptierten den überarbeiteten Text als Basis für die am 7. Dezember beginnenden Gespräche auf Ministerebene.
20. UN-Weltklimagipfel vom 1. bis 12. Dezember 2014 in Lima
20. UN-Weltklimagipfel vom 1. bis 12. Dezember 2014 in Lima
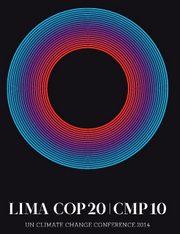
Der 20. UN-Klimagipfel fand in der peruanischen Hauptstadt Lima statt. Die Teilnehmerstaaten hatten sich vorgenommen, Grundlagen für einen Weltklimavertrag zu schaffen.
Nach zähem Ringen hat sich die UN-Klimakonferenz in Lima auf Eckpunkte für einen Weltklimavertrag geeinigt. Vertreter:innen von 195 Staaten verständigten sich zum Abschluss der zweiwöchigen Verhandlungen auf einen Rahmenentwurf für ein Abkommen, das Ende 2015 in Paris vereinbart werden soll. Aber die meisten Fragen sind noch offen. Nur das Ziel ist klar: Die Erderwärmung soll auf höchstens zwei Grad begrenzt werden.
Der Gipfel dauerte bis in die Nacht des 14. Dezember also länger als geplant. Erst dann ließ sich ein Kompromiss finden. Hauptstreitpunkt waren die Finanzen. Der Konsens sieht vor, dass alle Staaten eigene Klimaschutzbeiträge vorlegen. Die Staaten, die dazu in der Lage sind, sollen bereits bis März 2015 angeben, wie stark sie ihre Treibhausgas-Emissionen mindern können. Diese Ziele sollen transparent, vergleichbar und überprüfbar sein. Zusätzlich können die Staaten freiwillige Angaben über Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel machen. Der Entwurf ist eine Liste von Wünschen, die unverbindlich sind und noch zahlreiche Optionen enthalten. Verhandelt und entschieden wird erst in einem Jahr in Paris.
Die Vorgaben für die nationalen CO2-Minderungsziele fielen eher schwach aus. Angestrebt waren vergleichbare Kriterien. Das ist weitgehend misslungen, denn die Angaben sind de facto freiwillig.
Die Bundesregierung bewertete die Beschlüsse trotz einiger Aufweichungen als solide Basis für den geplanten Weltklimavertrag. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth sagte nach dem Gipfel: „Das waren sehr zähe Verhandlungen. Wir haben nun ein Ergebnis, das alle Möglichkeiten eröffnet, zu einem ambitionierten Klimavertrag zu kommen. Der ursprüngliche Entwurf ist noch einmal abgeschwächt worden. Das hätten wir uns als Europäische Union und in Deutschland anders gewünscht.“
Umweltschützer:innen sind von dem Ergebnis in Lima enttäuscht. Greenpeace sieht in den Beschlüssen keine echten Fundamente für den Weltklimavertrag. Die Umweltstiftung WWF spricht von einem Rückschlag.
UN Climate Change Conference 2014
Webseite der peruanischen Präsidentschaft für COP 20: UN-Klimakonferenz 2014
Neue Klimaziele zwischen den USA und China
Neue Klimaziele zwischen den USA und China
Die USA und China einigen sich am 12. November 2014 überraschend auf ehrgeizige Klimaschutzziele. Bei einem Treffen in Peking versprachen US-Präsident Barack Obama und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping, die Treibhausgase zu reduzieren. Die beiden Länder stoßen weltweit am meisten CO2 aus.
Die USA wollen ihre Emissionen bis 2025 im Vergleich zu 2005 um 26 bis 28 Prozent herunterschrauben. Ende 2015 soll in Paris bei einer UN-Klimakonferenz ein neues Abkommen zur Begrenzung der Erderwärmung für die Zeit nach 2020 ausgehandelt werden. Ob Präsident Obama sein Vorhaben jedoch durchsetzen kann, ist fraglich. Die Republikanische Mehrheit im US-Kongress kann das Klima-Gesetz verhindern. Die Klimaziele sind ihnen eigenen Angaben zufolge zu unrealistisch und würden Arbeitsplätze kosten.
China stellte eine CO2-Begrenzung zum Jahr 2030 oder auch früher in Aussicht. Es ist das erste Mal, dass China dafür ein ungefähres Datum nennt — bislang hatte die Regierung dies mit dem Hinweis auf einen Nachholbedarf bei der Industrialisierung abgelehnt. Darüber hinaus will China bis 2030 den Anteil nicht-fossiler Brennstoffe am Energiemix auf 20 Prozent erhöhen. Der Regierung zufolge lag der Anteil erneuerbarer Energien 2013 bei rund zehn Prozent. Für China sind die neuen Pläne ein großer Schritt. Das Land produziert 30 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Im Hinblick auf die Auswirkungen auf das Leben der Chinesinnen und Chinesen, zum Beispiel durch die Smogbelastung in Peking, sah sich die Regierung allerdings zum Handeln genötigt. Umweltschützer:innen feiern diese bahnbrechende Wende.
19. UN-Weltklimagipfel vom 11. bis 22. November 2013 in Warschau
19. UN-Weltklimagipfel vom 11. bis 22. November 2013 in Warschau
In der polnischen Hauptstadt Warschau fand vom 11. bis 22. November 2013 die 19. UN-Klimakonferenz statt. Dort sollten insbesondere die Verhandlungen für einen Welt-Klimavertrag fortgesetzt werden.
Einen echten Durchbruch auf dem Weg zum Weltklimavertrag hatten Experten vom Warschauer Gipfel nicht erwartet. Aber die Bilanz der Konferenz fiel selbst hinter die pessimistischen Erwartungen zurück. EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard warnte kurz vor Ende der Konferenz angesichts der kaum messbaren Fortschritte vor der Gefahr eines Rückfalls hinter bereits verabredete Ziele und davor, dass es nicht gelingen könnte, 2015 in Paris den geplanten weltweiten Klimavertrag mit verbindlichen Vorgaben zur Reduzierung der Treibhausgase zu schließen.
Während der Konferenz hatte Japan, begründet mit den Folgen der Atomkatastrophe in Fukushima, seine bisherigen Klimaziele gekippt. Zudem hatten Brasilien und China beantragt, bei den nationalen Reduktionszielen die historischen Treibhausgasmengen als Verantwortung den Industriestaaten anzurechnen, was die europäische Delegation als zusätzliche Schwierigkeit für eine Einigung ansah.
Angesichts der fehlenden Fortschritte bei der Konferenz hatten erstmals in der Verhandlungsgeschichte die großen Umweltorganisationen das Konferenzgebäude vor Abschluss des Treffens verlassen. Die Organisationen und Aktivist:innen, darunter Greenpeace, WWF, BUND und Oxfam, protestierten mit der Aktion gegen die schleppenden Verhandlungen. „Der Klimawandel ist eine Realität, aber hier in Warschau ist keinerlei Fortschritt zu sehen“, sagte Greenpeace-Chef Kumi Naidoo.
Begleitet wurde die Konferenz von weiteren Protestaktionen. Der Delegierte der Philippinen hat in einer emotionsgeladenen Rede zu entschiedeneren Anstrengungen gegen den Klimawandelt aufgerufen. Naderev M. Saño berichtete von den dramatischen Auswirkungen des Taifuns Haiyan in seiner Heimat und kündigte an, so lange zu fasten, bis die Klimakonferenz eine bedeutsame Vereinbarung erzielt habe. In Folge schlossen sich mehr als 60 Konferenzteilnehmer:innen diesem Hungerstreik an.
Fast schon skuril war die Entlassung des polnischen Umweltministers Marcin Korolec während der Konferenz. Korolec war jedoch in Warschau nicht irgendein Konferenzteilnehmer, sondern der Präsident des Klimagipfels.
Erst in Nachverhandlungen nach dem offiziellen Ende der Konferenz gelang eine Einigung auf einen Fahrplan für den Weltklimavertrag, der bis 2015 in Paris abgeschlossen werden soll. Der wichtigste Punkt, die verbindliche Festlegung der Klimaschutzziele der einzelnen Staaten, wurde dabei jedoch vertagt. Weitere Ergebnisse konnten lediglich beim Waldschutz und dem Thema Anpassung ärmerer Staaten an den Klimawandel erzielt werden. Das Waldkapitel (REDD+) war schon seit dem spektakulär gescheiterten Weltklimagipfel in Kopenhagen 2009 mehr oder weniger ausverhandelt, konnte nun aber auch in der Finanzierung gesichert werden. Waldreiche Länder sollen Geld dafür bekommen, dass sie ihre Wälder nicht abholzen oder wieder aufforsten. Der Adaptation Fund, mit dem Anpassungsmaßnahmen ärmerer Staaten an den Klimawandel finanziert werden können, konnte durch die Europäer gerettet werden, weil neben Deutschland dann auch Belgien, Frankreich, Finnland, Norwegen, Österreich, Schweden und die Schweiz Gelder in Höhe von insgesamt 100 Millionen US-Dollar zusagten.
Vertreter:innen von Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, die die Konferenz am Donnerstag unter Protest verlassen hatten, zeigten sich von den Ergebnissen der Konferenz enttäuscht. „Der derzeitige Text über Finanzen ist nichts als eine Übung in sprachlicher Yoga“, sagte Oxfam-Direktorin Winnie Byanyima. „Im dritten Jahr in Folge haben die (Teilnehmer-)Länder einen neuen Weg gefunden, absolut nichts zu sagen. Das wird einige der ärmsten und am schwersten von Klimafolgen betroffenen Länder der Welt mit tiefen Löchern in ihren bereits knappen Budgets zurücklassen.“
Die nächste Klimakonferenz der Vereinten Nationen wird Ende 2014 in der perunanischen Hauptstadt Lima stattfinden.
Webseite der UNFCCC für COP19: Un-Klimakonferenz 2013
Webseite der polnischen Präsidentschaft für COP 19: UN-Klimakonferenz 2013
18. UN-Weltklimagipfel vom 26. November bis 7. Dezember 2012 in Doha
18. UN-Weltklimagipfel vom 26. November bis 7. Dezember 2012 in Doha
In Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, fand vom 26. November bis 7. Dezember 2012 die 18. UN-Klimakonferenz statt. Schon im Vorfeld waren die Voraussetzungen für die Konferenz problematisch und die Delegierten mussten lange verhandeln, um überhaupt zu einer Einigung zu kommen. Am Ende kamen die Delegierten der fast 200 Teilnehmerstaaten nur einen kleinen Schritt im Vergleich zur Klimakonferenz in Durban 2011 weiter. Konkret beschlossen wurde, das Kyoto-Protokoll ohne schärfere Verpflichtungen bis 2020 zu verlängern und die Entscheidung für ein weltweites Abkommen für Klimaschutz auf 2015 zu vertagen.
Mit der „Kyoto II“-Regelung verpflichten sich 37 Industriestaaten, ihren Ausstoß von Treibhausgasen weiter zu reduzieren. Darunter sind die 27 Staaten der EU. Gemeinsam sind diese Staaten für etwa 15 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Russland, Kanada, Japan und Neuseeland beteiligen sich nicht an der Verlängerung des Kyoto-Protokolls und die größten Klimasünder, China und die USA, haben die Vereinbarung nie unterschrieben und werden sich auch weiterhin nicht beteiligen. Das Kyoto-Protokoll läuft Ende 2012 aus und ist das bisher einzige internationale Abkommen, das die Unterzeichner zur Verringerung klimaschädlicher CO2-Emissionen verpflichtet.
Die Verhandlungen zur Verlängerung des Kyoto-Protokolls drohten bis zuletzt zu scheitern, weil erst Polen und später Russland Vorbehalte anmeldeten. Sie wollten keine strengen Auflagen für den Handel mit überschüssigen CO2-Verschmutzungsrechten. Man einigte sich darauf, dass Staaten Emissionsrechten aus der Zeit vor dem Abkommen, sogenannte „Hot Air“, weiter nutzen und unter bestimmten Einschränkungen auch verkaufen dürfen, sogar noch über 2020 hinaus.
An anderer Stelle wurde die Regelung verschärft: Zu den sechs bislang entsprechend ihrer Klimaschädlichkeit in die CO2-Bilanz eingerechneten Treibhausgasen kommt im neuen Abkommen ein siebtes hinzu: Stickstofftrifluorid (NF3) dient zur Produktion von Flachbildschirmen und Solarzellen und wird oftmals als Ersatz für das verbotene FCKW eingesetzt. Seine Produktionsmenge ist seit Mitte der Neunziger Jahre stark gestiegen.
Am Ende erklärte der katarische Konferenzpräsident Abdullah bin Hamad al Attijah ohne weitere Rücksprache, die Konferenz habe die Annahme der Beschlussvorlage einmütig befürwortet. Die russische Delegation protestierte gegen dieses Vorgehen. Doch Russland nimmt an der zweiten Kyoto-Periode nicht teil.
Die neue Kyoto-Periode soll zum Jahreswechsel beginnen. 2014 sollen die festgelegten Emissionsziele überarbeitet und wenn möglich nachgebessert werden. Für die EU wäre dies eine Gelegenheit, ihr Emissionsziel für 2020 von minus 20 auf minus 30 Prozent zu erhöhen. Dieses Vorhaben scheitert bislang am Widerstand Polens.
Ein Weltklimavertrag, an dem sich alle Länder beteiligen, soll bis 2015 ausgehandelt werden und ab 2020 in Kraft treten. In Doha wurde dafür ein grober Arbeitsplan beschlossen. Im kommenden Jahr sollen weitere Schritte geklärt werden, um die Lücke bis 2020 zu überbrücken und den Treibhausgasausstoß weiter zu drosseln. Spätestens auf der Klimakonferenz Ende 2014 sollen erste Elemente eines neuen Vertrages feststehen. Spätestens im Mai 2015 soll ein erster Entwurf vorliegen. 2014 will UN-Generalsekretär Ban Ki Moon die Staats- und Regierungschefs zu einem Klimagipfel einladen.
Erneut bekräftigt wurde in Doha, Entwicklungsländern ab 2020 pro Jahr 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz und Anpassung an Klimafolgen zur Verfügung zu stellen. Allerdings gab es keine Aussagen darüber, wie das Geld zusammenkommen soll. Für die Zeit bis 2020 wurde allgemein festgestellt, dass die Mittel aufgestockt werden sollen. Wirklich konkret blieben nur Zusagen, die von einigen europäischen Ländern für die Zeit bis 2015 gemacht wurden. Insgesamt rund sieben Milliarden Euro wollen diese Staaten jährlich ausgeben. Deutschland will sich mit 1,8 Milliarden Euro beteiligen. Eine Arbeitsgruppe soll ausloten, wie das Gesamtziel erreicht werden kann.
Viele Umweltverbände sind vom Ergebnis des Klimagipfels enttäuscht. Die vagen Ankündigungen und die viel zu geringen finanziellen Mittel würden nicht ausreichen, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu halten. „Der Klimaschutz ist in Doha auf der Strecke geblieben. Die wachsweichen Beschlüsse der Konferenz leisten keinen Beitrag, um den globalen Temperaturanstieg zu bremsen“, sagte Hubert Weiger, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Ende des UN-Klimagipfels.
COP18: Un-Klimakonferenz 2012
Spiegel-Online: Uno-Klimakonferenz in Doha 2012
heute.de: "Keinen Millimeter in Richtung mehr Klimaschutz"
Süddeutsche: Klimakonferenz
17. UN-Weltklimagipfel vom 28. November bis 11. Dezember 2011 in Durban
17. UN-Weltklimagipfel vom 28. November bis 11. Dezember 2011 in Durban

Vom 28. November bis 11. Dezember 2011 fand in Durban (Südafrika) die UN-Klimakonferenz statt. Es war die 17. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention (COP 17) und die 7. Vertragsstaatenkonferenz des Kyoto-Protokolls (CMP 7).
Die UN-Klimakonferenz hat abschließend doch noch einen Fahrplan für ein neues globales Klimaschutzabkommen beschlossen. Nach tagelangen Diskussionen stimmten die Delegierten aus mehr als 190 Staaten dem gemeinsam erarbeiteten Text zu. Der sogenannten „Durban Plattform“ zufolge soll das neue Abkommen bis 2015 erarbeitet und 2020 in Kraft treten. Es enthält verschiedene Formen der rechtlichen Verbindlichkeit. Die EU hatte am Ende der Konferenz einen Fahrplan zu einem Weltklimavertrag durchgesetzt, der auch Klimasünder wie die USA, China und Indien in die Pflicht nimmt. Erstmals in der Geschichte der Klimadiplomatie wollen sich alle Staaten auf ein rechtlich verbindliches Abkommen einlassen.
Die neue zweite Verpflichtungsperiode des Kyoto-Protokolls soll von 2013 bis 2020 dauern. Die einzelnen Staaten sollen bis Mai 2012 Vorschläge für ihre Minderungsziele vorlegen, die sie in die zweite Verpflichtungsperiode für das Kyoto-Protokoll einbringen werden. In der ersten Periode, die Ende 2012 ausläuft, hatten sich 37 Industriestaaten dazu verpflichtet, ihre Treibhausgas-Emissionen um durchschnittlich fünf Prozent verglichen mit dem Stand von 1990 zu verringern. Die USA, Indien und China beteiligten sich jedoch nicht daran. Bis 2020 wird nun eine CO2-Reduzierung um insgesamt 25 bis 40 Prozent angestrebt.
Der Klimagipfel von Durban hat ein mehrere hundert Seiten umfassendes Paket verabschiedet. Es enthält viele Einzelaspekte. Bedeutend sind unter anderem:
- Verlängerung des Kyoto Protokolls bis 2017 oder 2020. Ein Nachfolgeabkommen soll 2012 in Katar ausgearbeitet werden.
- Einrichtung einer Arbeitsgruppe, die bis spätestens 2015 ein neues Protokoll oder eine andere Vereinbarung mit rechtlicher Kraft ausarbeitet. Diese neue Vereinbarung soll 2020 in Kraft treten.
- Die Schaffung eines Clean Climate Funds zur Verwaltung eines Teils der jährlich 100 Milliarden Dollar, die die Industrieländer den Entwicklungsländern ab 2020 versprochen haben.
- Verbesserungen beim Schutz der tropischen Regenwälder sowie die Schaffung von Institutionen, die Entwicklungsländern bei der Anpassung an den Klimawandel helfen.
- Der Transfer von Klimaschutztechnologien an Entwicklungsländer soll erleichtert werden.
- Verbessert wurde zudem die Kontrolle der Emissionen von Entwicklungsländern.
„Das Paket von Durban ist ein großer, wegweisender Erfolg für den Klimaschutz“, sagte Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) in Durban. „Wir haben jetzt das Fundament und die Dynamik dafür, ein internationales Klimaschutzabkommen zu erreichen, das erstmalig für alle gilt“, betonte Röttgen. Es gebe einen Fahrplan „zu einem rechtsverbindlichen, globalen Klimaschutzabkommen“.
Die Umweltorganisationen WWF und Greenpeace kritisierten, die EU habe bei der Frage einer strengen Rechtsverbindlichkeit bei dem bis 2015 geplanten Weltklimaabkommen nachgegeben. Mit dem Klimavertrag, der zudem erst 2020 in Kraft treten soll, werde es nicht zu schaffen sein, die Erderwärmung wie angestrebt auf zwei Grad zu begrenzen.
Spiegel-Online: Klimagipfel in Durban
16. UN-Weltklimagipfel vom 29. November bis 10. Dezember 2010 in Cancún
16. UN-Weltklimagipfel vom 29. November bis 10. Dezember 2010 in Cancún

Der Klimawandel macht sich immer mehr bemerkbar. 2010 ist ein von Umweltkatastrophen geprägtes Jahr: Überflutungen in Pakistan, Hitzewelle und Dürre in Russland, Überschwemmungen und Erdrutsche in China. Im Zuge der weiteren Erwärmung des Klimas werden solche Katastrophen noch häufiger vorkommen. Die jüngsten Daten sind alarmierend: 2010 ist wohl eines der wärmsten Jahre weltweit — und das aktuelle Jahrzehnt das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Bei der 16. UN-Klimakonferenz im mexikanischen Badeort Cancún haben Vertreter:innen aus 194 Staaten abermals über die Möglichkeiten, den Klimawandel einzudämmen, beraten. Ziel der Konferenz war es, den Anstieg der Erdtemperatur möglichst auf zwei Grad zu begrenzen, um unter anderem die weitere Zunahme von schweren Unwettern, wie 2010 in Pakistan, zu verhindern.
2009 hatten sich die Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen auf dieses Ziel geeinigt, allerdings nicht, wie es erreicht werden soll. Staaten wie die USA, China, Indien und Brasilien waren damals nicht bereit, verbindliche Zusagen zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes (CO2) zu machen. Auch wurde kein Nachfolgeabkommen für den Kyoto-Klimaschutzvertrag beschlossen.
Das Kyoto-Protokoll, in dem sich zumindest die Industriestaaten zu konkretem Klimaschutz verpflichtet haben, endet 2012. Und für die Zeit danach gibt es keinerlei Regelung. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte im Oktober dazu: „Cancún kann ein wichtiger Schritt werden, es wird aber mitnichten ein Nachfolgeabkommen für den Vertrag von Kyoto bringen.“
Beobachter:innen gingen nicht davon aus, dass in Cancún eine Einigung gelingen würde. In der Schlussphase der Klimakonferenz von Cancún konnte sich die Staatengemeinschaft allerdings doch noch auf einen Kompromiss verständigen, in dem zumindest Minimalziele beschlossen wurden. Die Beschlüsse des Klimagipfels sind ein Schritt in die richtige Richtung. Der Weg bis zu einem echten Klimaschutzabkommen ist aber noch weit und bedarf großer Anstrengungen der Industrie- und Entwicklungsländer.
Es wurden zwei Abkommen beschlossen, die in zwei verschiedenen Verhandlungssträngen ausgearbeitet wurden.
- So soll das Kyoto-Protokoll vorerst fortgeführt werden und
- ärmere Länder sollen umfangreiche Finanzmittel zur Bekämpfung der Klimawandel-Folgen zur Verfügung gestellt bekommen.
Es wurde ein Hilfsfonds beschlossen, von dem die von der Erwärmung am stärksten betroffenen Staaten profitieren sollen. Finanziert wird er von den Industriestaaten. Diese sollen bis 2012 jährlich 30 Milliarden US-Dollar einzahlen, ab dem Jahr 2020 sogar 100 Milliarden Dollar.
Das zweite Abkommen soll als Grundlage für ein Nachfolgeabkommen des Kyoto-Vertrags dienen. Die Staatengemeinschaft erkennt darin die Ergebnisse des Weltklimarats IPCC an und drängt die Industrieländer dazu, ihre CO2-Einsparmaßnahmen aufzustocken. Zum ersten Mal wurde das Zwei-Grad-Ziel offiziell von der Weltgemeinschaft anerkannt. Konkrete CO2-Einsparziele enthält das Abkommen allerdings nicht. Auch verpflichtet das Abkommen weder die USA, da diese das Kyoto-Protokoll nicht unterzeichnet hat, noch Indien und China, die weiterhin zu den Entwicklungsländern gerechnet werden, zu einer Minderung ihrer Treibhausgas-Emissionen.
Da das Papier nur ein indirektes Bekenntnis zur Fortsetzung des Kyoto-Protokolls enthält, kann ein Nachfolgeabkommen frühestens auf dem nächsten UN-Klimagipfel Ende 2011 im südafrikanischen Durban beschlossen werden. Es gilt deshalb als sicher, dass es zwischen dem Auslaufen der ersten Periode des Kyoto-Protokolls Ende 2012 und dem Inkrafttreten der zweiten Periode eine Lücke geben wird, da die Ratifizierung eines Nachfolgeabkommens durch die einzelnen Länder voraussichtlich Jahre dauern wird.
Spiegel online: Uno-Klimakonferenz in Cancún 2010
FAZ.NET: Klimakonferenz in Cancún
Zeit online: Klimakonferenz in Cancún
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Die Verhandlungen in Cancún
15. UN-Weltklimagipfel bis 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen
15. UN-Weltklimagipfel bis 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen
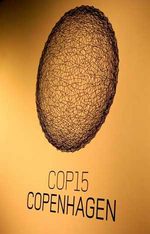
Im Dezember 2009 trafen sich die Regierungen der Vereinten Nationen in Kopenhagen, um ein neues internationales Klimaabkommen auszuhandeln. 15.000 Teilnehmer:innen aus 193 Ländern versuchten bei der 15. Klimakonferenz, die Erde vor den Folgen der globalen Erderwärmung zu bewahren. Gerungen wurde um ein Folgeabkommen für das Kyoto-Abkommen, es sollte 2013 in Kraft treten. Ziel der Konferenz war ein Abkommen, das die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius hält und die besonders Betroffenen bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt.
Entscheidend für einen Erfolg der Konferenz wären zwei besonders strittige Punkte gewesen:
Erstens müssten sich die Industrieländer auf verbindliche Ziele zur Treibhausminderung einigen. Die IPCC erklärte bereits 2007, dass eine Minderung von 25-40 Prozent bis 2020 gegenüber 1990 notwendig sei, um den Klimawandel kontrollierbar zu halten. Bis jetzt sind die Industrieländer dazu kaum bereit. Die EU etwa hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 20 Prozent zu senken — und zwar gegenüber dem Vergleichsjahr 1990. Falls die übrigen Industriestaaten mitmachen, will die EU ihre Emissionen gar um 30 Prozent senken. Die USA haben zwar die Wichtigkeit des Klimaschutzes erkannt, geben aber als Ziel bis jetzt 17 Prozent bis 2020 im Vergleich zu 2005 an. Ob der US-Senat, wo derzeit über ein Klimaschutzgesetz gestritten wird, diese Ziele unterstützt, ist unklar. Nach Berechnungen von Expert:innen würde diese Reduzierung lediglich eine Verringerung um etwa vier Prozent unter das Niveau des Jahres 1990 bedeuten. Die Schwellenländer sind zwar grundsätzlich bereit, ihren Beitrag zu leisten, verlangen aber von den Hauptverursachern des Klimawandels, den Industrieländern, zuerst feste Reduktionsziele.
Zweitens müssen sich die Industrieländer auf verbindliche Finanzhilfen für die Entwicklungsländer einigen, damit diese klimafreundlicher werden können und sich an die Folgen des Klimawandels anpassen können. In den Vorverhandlungen waren die Industrienationen allerdings nicht bereit, konkrete Zahlen zu nennen.
Auf lange Sicht soll die Durchschnittstemperatur auf nicht höher als zwei Grad über dem Wert vor der Industrialisierung steigen. Darauf hatten sich die großen acht Industriestaaten und die Schwellenländer China, Indien, Brasilien und Mexiko im Sommer auf dem G-8-Gipfel in L'Aquila verständigt.
Das Zwei-Grad-Ziel kann nur erreicht werden, wenn der globale Ausstoß an Treibhausgasen radikal sinkt. Die weltweiten Emissionen müssten bis zum Jahr 2050 um die Hälfte sinken, verglichen mit dem Stand von 1990. Noch größere Differenzen gibt es darüber, wer den größten Teil der finanziellen Lasten zu tragen haben wird und wie (auch juristisch) verbindlich die Staaten sich verpflichten sollen, ihre Emissionen zu senken.
Die EU bietet den Entwicklungsländern Finanzhilfen für Sofortklimamaßnahmen in Höhe von mindestens 7,2 Milliarden Euro an. Zwei Tage lang hatten die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer beim EU-Gipfel in Brüssel über diese Zusage verhandelt. Sie gilt für die Jahre 2010 bis 2012. Weiter offen ist der Beitrag, den Europa zur langfristigen Finanzierung anbieten wird.
Der Weltklimagipfel in Kopenhagen konnte sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Die politische Vereinbarung, die zuvor von 25 Staats- und Regierungschefs ausgehandelt wurde, nahm das Plenum lediglich „zur Kenntnis“. Das Papier dient damit nur als Grundlage für die künftigen Beratungen. Am Ziel, ein Nachfolgeabkommen für das Kyoto-Protokoll zu vereinbaren, war der Gipfel gescheitert.
Die Kopenhagen-Vereinbarung (Copenhagen Accord) enthält nur sehr vage Klimaschutzziele. Die Begrenzung der Erderwärmung auf zwei Grad, die Wissenschaftler:innen für dringend notwendig halten, soll lediglich „berücksichtigt“ werden. Die Industrieländer sollen nationale Klimaschutzziele vorlegen. Kurz- und langfristige Finanzhilfen der reicheren Staaten für die Entwicklungsländer sind vorgesehen, bindende Verpflichtungen aber nicht.
Punkte der Kopenhagen-Vereinbarung:
- Ausstoß von Treibhausgasen: Der Text enthält das allgemeine Bekenntnis, die Erderwärmung auf maximal zwei Grad zu begrenzen. Industriestaaten und Schwellenländer werden nationale Minderungsziele bis zum 1. Februar 2010 anmelden.
- Kontrolle: Länder sollen ihre Maßnahmen auflisten, mit denen der Ausstoß von Treibhausgasen um eine bestimmte Menge begrenzt wird. Um die Kürzungen zu verifizieren, soll international die Verständigung auf eine Methode erfolgen. Die Souveränität der einzelnen Länder solle aber respektiert werden. Konkretere Details zu Methoden der Überprüfung liegen aber nicht vor.
- Finanzierung: Die Industriestaaten sollen bis 2012 insgesamt 30 Milliarden Dollar aufbringen, um ärmeren Staaten bei dem Wechsel zu sauberer Energie und bei der Bewältigung des Klimawandels wie etwa Dürren und Überschwemmungen zu helfen. Bis 2020 sollen — abhängig von der Höhe und der Transparenz bei den Reduktionsmaßnahmen — jährlich 100 Milliarden Dollar zusammen kommen.
Das Papier sah darüber hinaus eine Überprüfung der Umsetzung bis Ende 2015 vor.
14. UN-Weltklimagipfel vom 1. bis 12. Dezember 2008 in Posen/Polen
14. UN-Weltklimagipfel vom 1. bis 12. Dezember 2008 in Posen/Polen

Der Weltklimagipfel im polnischen Posen ist nach zwölf Tagen ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Die Entscheidungen über eine verbindliche Verringerung der Treibhausgas-Emissionen für jedes Land sollen erst im kommenden Jahr gefällt werden, teilte das UN-Klima-Sekretariat mit. Die zweiwöchige UN-Konferenz in Posen mit rund 11.000 Teilnehmer:innen sollte die Grundlagen für ein neues weltweites Klimaabkommen legen, das Ende 2009 in Kopenhagen festgeschrieben und 2013 in Kraft treten soll. Ziel ist die drastische Verringerung der Treibhausgase. Zu Minderungszielen wurde in Posen aber noch nichts vereinbart.
Die rund 190 Staaten einigten sich darauf, dass die Entwicklungsländer einen leichteren Zugang zu einem bestehenden Hilfsfonds erhalten, aus welchem die Gelder bisher noch nicht abgerufen werden konnten. Der Fonds dient zur Anpassung der ärmeren Staaten an den Klimawandel. Die Industrieländer konnten sich nicht darauf einigen, die Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen bis 2020 zwischen 25 und 40 Prozent konkret festzuschreiben. Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Weltklimarates werden berücksichtigt, aber weiter nur in einer Fußnote. Beim Waldschutz kamen die Staaten nicht über den Stand der Klimakonferenz in Bali 2007 hinaus. Die Finanzierung hierfür ist weiter unklar. Während sich das UN-Klimasekretariat zufrieden zeigte, reagierten Entwicklungsländer enttäuscht.
Bis zur Klimakonferenz in Kopenhagen Ende 2009 sind zwei weitere Treffen auf Delegiertenebene geplant. Vom 29. März bis 8. April soll eine Arbeitskonferenz am Sitz der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) in Bonn die Vorbereitung des Abkommens von Kopenhagen weiterführen. Vom 1. bis 12. Juni ist ebenfalls in Bonn eine weitere UNFCCC-Konferenz geplant. Dabei sollen die Vorsitzenden verschiedener Arbeitsgruppen der Klimarahmenkonvention und des Kyoto-Protokolls einen Vertragsentwurf vorlegen, der dann Grundlage der weiteren Verhandlungen ist.
Umweltschützer:innen zogen eine bittere Bilanz. WWF-Klimadirektor Kim Carstensen sagte, die Konferenz sei eine Zeitverschwendung gewesen.
The United Nations Climate Change Conference, Pozna?, Poland - COP 14 1-12 December 2008
13. UN-Weltklimagipfel vom 13. bis 14. Dezember 2007 auf Bali
13. UN-Weltklimagipfel vom 13. bis 14. Dezember 2007 auf Bali

Vom 3. bis 14. Dezember 2007 fand auf Bali die 13. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention und die 3. Vertragsstaatenkonferenz des Kyoto-Protokolls statt. Die Klimakonferenz gilt als wichtigste internationale Verhandlungsrunde zum Klimaschutz seit Jahren. Noch nie stand der Klimaschutz so sehr im Fokus der Weltöffentlichkeit und der Politik. Die Klimakonferenz von Bali hat jetzt den Fahrplan für ein neues Klimaschutzabkommen vereinbart.
Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen wurde unter dem Vorsitz des indonesischen Umweltministers Rachmat Witoelar und mit der Unterstützung des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) durchgeführt. Es wurden mehr als 10.000 Teilnehmer:innen erwartet. Das Hauptziel der Konferenz war, die Verhandlungen über ein neues internationales Klimaschutzabkommen zu beginnen. Die Konferenz sollte kein vollständig ausgehandeltes und beschlossenes Klimaabkommen liefern, aber die dafür notwendigen Schritte einleiten. Es wurde erwartet, dass sich die Vertragsstaaten über die Kernbereiche, die das neue Abkommen umfassen sollte, einigen, wie beispielsweise Klimaschutzmaßnahmen (inklusive die Vermeidung von Abholzung), Anpassungsmaßnahmen, Technologie und Finanzierung. Es wurde auch erwartet, dass die Vertragsstaaten sich darauf einigen, dass die Verhandlungen im Jahre 2009 abgeschlossen sein sollten. Der Kyoto-Vertrag läuft 2012 aus. Spätestens in acht Jahren muss Klimaexpert:innen zufolge der Ausstoß der erderwärmenden Gase den Scheitelpunkt erreicht haben und dann zurückgehen, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu verhindern.
Mit 192 Vertragsstaaten verfügt die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) über eine fast universale Mitgliedschaft und wird durch das 1997 verabschiedete Kyoto-Protokoll mit heute 176 Vertragsstaaten ergänzt. Im Rahmen des Kyoto-Protokolls haben sich 37 Industrie- und Schwellenländer zu verbindlichen Emissionsbeschränkungen und Reduktionszielen verpflichtet, während Entwicklungsländer nicht-bindende Verpflichtungen zur Emissionsreduktion eingegangen sind. Ziel beider Verträge ist, die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, auf dem gefährliche Auswirkungen des menschlichen Handelns auf das Klimasystem verhindert werden können.
Zwei Wochen vor dem Klimagipfel auf Bali hat der Chef des UN-Klimasekretariats (UNFCCC) Yvo de Boer einen „beunruhigenden Trend bei der Entwicklung der Treibhausgasemissionen“ festgestellt. Der Ausstoß von Klimagasen habe 2005 „nahe einem Allzeithoch“ gelegen.
Die EU strebt an, einen umfassenden Verhandlungsprozess, die „Bali Roadmap“ zu vereinbaren. In ihr sollen die wesentlichen Verhandlungsinhalte beschrieben und ein Verhandlungszeitplan festgelegt werden.
Zum 1. Januar 2013 soll ein neues Abkommen in Kraft treten, es soll weit ehrgeizigere Ziele enthalten, es soll die USA, China und Indien ebenso einbinden wie weitere Schwellenländer. Selten stand eine Klimakonferenz unter solchem Erfolgsdruck, selten war der Druck der Öffentlichkeit so groß wie diesmal. Drei Jahre davor — zur Weltklimakonferenz Ende 2009 in Kopenhagen — soll das neue Abkommen unter Dach und Fach sein, damit keine zeitliche Lücke entsteht und es rechtzeitig für die Zeit nach 2012 ratifiziert werden kann.
Die Weltklimakonferenz kann einen ersten Erfolg verbuchen: Die Konferenz hat einen Kompromiss beim Aufbau eines Klimafolgen-Anpassungsfonds erzielt, der Entwicklungsländer unterstützen soll, die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Der Anpassungsfonds, den Entwicklungsländer nachdrücklich gefordert hatten, soll bis 2012 ein Volumen von 500 Millionen Dollar erreichen, etwa das Zehnfache der bisherigen Summe. Die Verwaltung soll ein Rat mit 16 Mitgliedern übernehmen, der im Rahmen des Globalen Umweltfonds (GEF) eingerichtet wird. Finanziert werden soll der Fonds durch eine zweiprozentige Abgabe auf Erlöse aus sogenannten CDM-Projekten im Rahmen des Emissionshandels. Das sind Maßnahmen, mit denen Verpflichtungen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes in Industriestaaten ersatzweise in Entwicklungs- oder Schwellenländern erbracht werden können.
Nach zweiwöchigen Diskussionen kam es erst in der Verlängerung zum Durchbruch. Die USA bekannten sich dabei erstmals zum Klimaschutz, womit auch die Front der bisherigen Klimaschutzgegner Japan, Kanada und Russland bröckelte. Die Weltgemeinschaft wurde mit der „Bali Roadmap“ in einen Fahrplan in Richtung neuer Klimavereinbarungen eingebunden. Kernpunkt der Vereinbarung sind Maßnahmen gegen den weltweit bislang ungebremsten Ausstoß von Treibhausgasen. Unter Verweis auf die jüngsten Berichte des Weltklimarats (IPCC) und dessen Warnungen vor einer Klimakatastrophe sollen deutliche Einschnitte bei den globalen Treibhaus-Emissionen erfolgen. Die Länder konnten sich noch nicht auf feste Grenzwerte beim Ausstoß von klimaschädlichen Gasen einigen. In der Abschlusserklärung ist von „tiefen Einschnitten bei den weltweiten Emissionen“ die Rede. In der Erklärung wurde zwischen reichen und armen Ländern unterschieden. Erstmals festgeschrieben wurde, dass nicht nur die Industriestaaten, sondern auch die Entwicklungs- und Schwellenländer einen Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen.
Über eine Nachfolge des Kyoto-Protokolls besteht nun Konsens. Mit der „Bali Roadmap“ können formale Verhandlungen vorbereitet werden. Erste Gespräche sollen bis April 2008 geführt werden. Ende 2009 soll in Kopenhagen ein neuer Klimavertrag vereinbart werden und 2013 das auslaufende Kyoto-Protokoll ablösen. Vorrangig werden dabei auch wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie die Armutsbekämpfung diskutiert. Bali ist damit ein Erfolg für die Staatengemeinschaft. Die USA haben erstmals die Bereitschaft angedeutet, sich auch international verbindlichen Emissionszielen anzuschließen. Auch die großen Schwellenländer China und Indien wurden erstmals eingebunden. Bali setzte auch historische Zeichen: So wurde der Schutz der Tropenwälder erstmals in die Klimarahmenkonvention aufgenommen. Beschlossen wurden auch Regeln für den Technologietransfer, mit dem Industriestaaten Entwicklungsländer zum Beispiel bei Energieeffizienz und Umwelttechnik unterstützen sollen.
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat das Ergebnis der UN-Klimakonferenz auf Bali begrüßt. Das Schlussdokument sei ein erster entscheidender Schritt hin zu einer Einigung, um die Gefahr des Klimawandels in den Griff zu bekommen.
Bundesumweltminister Sigmar Gabriel (SPD) begrüßte den Ausgang der Klimaschutzkonferenz auf Bali als „mühsam errungenen, aber tragfähigen Kompromiss mit substantiellen Festlegungen.“ Er sagte nach Beendigung der zweiwöchigen Klimakonferenz: „Das Signal von Bali lautet: Die Staatengemeinschaft will in den kommenden zwei Jahren ein Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll aushandeln. Und: Sowohl Industrieländer als auch Entwicklungsländer wollen ihre Anstrengungen für den Klimaschutz verstärken. Gemessen daran, wie festgefahren die Situation noch auf dem letzten Klimagipfel in Nairobi war, ist Bali ein großer Fortschritt.“
UNFCCC: Welcome to the United Nations Climate Change Conference in Bali
bpb: Klimakonferenz auf Bali
FAZ: Weg frei für ein neues Klimaabkommen
Spiegel: Bali-Konferenz
sueddeutsche.de: Die Parteien auf dem Klimagipfel - Wer will was auf Bali
ZDFheute: Bali soll Startschuss für neuen Klimavertrag geben
UN-Weltklimagipfel am 24. September 2007 in New York
UN-Weltklimagipfel am 24. September 2007 in New York
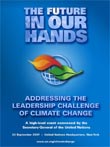
UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hatte zu der eintägigen Klima-Konferenz in New York geladen, um ein weiteres Treffen im Dezember auf Bali in Indonesien vorzubereiten. Dann soll mit der Arbeit an einem Kyoto-Nachfolgeabkommen begonnen werden. Dieses läuft 2012 aus. Einen Tag vor Beginn der UN-Generalversammlung waren 70 Staats- und Regierungschefs Bans Einladung gefolgt, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Noch nie hat es zum Klimawandel eine so hochrangig besetzte Konferenz gegeben. Ban Ki Moon hat die Staaten zu raschen Schritten gegen den Klimawandel aufgerufen. Zum Auftakt einer Klima-Konferenz von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt malte Ban ein dramatisches Bild von den Folgen der Erderwärmung. „Die Zeit der Zweifel ist vorüber“, sagte Ban. „Wenn wir nicht handeln, werden die Folgen des Klimawandels zerstörerisch sein.“
Bundeskanzlerin Merkel hat für ein neues Klimaschutzabkommen unter dem Dach der Vereinten Nationen (UN) geworben. Die intelligent und fair organisierte Verringerung von CO2-Emissionen zahle sich für alle aus, betonte die Kanzlerin bei den UN. Das gelte für die Industrienationen genauso wie für die Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Bundeskanzlerin warb auf dem Gipfel dafür, alles zu tun, damit in Bali der Fahrplan für ein neues UN-Klimaschutzabkommen für die Zeit nach 2012 verabschiedet werden kann. Ein Nachfolgeabkommen für Kyoto bilde „die Brücke, über die alle Länder zu einer nachhaltigen Entwicklung gelangen können“, ist Merkel überzeugt. Merkel betonte erneut, die Industrieländer müssten bei der Reduzierung von Treibhausgasen eine Vorreiterrolle spielen. Dies sei eine „moralische und wirtschaftliche Notwendigkeit“. Zugleich erinnerte sie an die klimapolitische Strategie der Europäischen Union (EU), die im Frühjahr unter der deutschen Präsidentschaft beschlossen worden war. Bis zum Jahr 2020 wollen die Europäer die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um mindestens 20 Prozent senken. Im Rahmen eines UN-Abkommens, bei dem alle Staaten einen fairen Beitrag leisten, würde die EU noch einmal zehn Prozent drauflegen. Das neue Abkommen müsse allerdings alle Nationen ins Boot holen und motivieren, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen, betonte Merkel. Wenn alle mitmachten, könnten im Ergebnis auch alle von neuen Technologien profitieren.
US-Außenministerin Condoleezza Rice bekannte sich klar zu einem Klimaschutz unter dem Dach der Vereinten Nationen, machte aber deutlich, dass die USA mehr auf neue Technologien als auf den Abbau von Treibhausgasen setzen. Es müsse gelingen, die fossilen Brennstoffe durch saubere Energien zu ersetzen. „Die Welt braucht eine technologische Revolution.“
UN High Level Event zum Klimawandel (englisch)
E-Learning-Kurs für Schulklassen
eSchool4S
Sustainability - Nachhaltigkeit

Aus dem EU-geförderten Projekt „eSchool4s“ sind sechs englischsprachige Kurse rund um das Thema Nachhaltigkeit hervorgegangen. Ob Klimawandel, nachhaltiger Konsum oder Inklusion – Schüler:innen können sich in einem Internet-Kursraum interaktiv zu einer großen Bandbreite an Themen weiterbilden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Donauraum. Geeignet für die Altersgruppe ab 15 Jahren. In Baden-Württemberg wird das Projekt „eSchool4S“ vom Landesministerium für Kultus, Jugend und Sport gefördert.
Within the framework of the EU-funded project “eSchool4S” six courses in English language, addressing different dimensions of sustainability, were developed. In an interactive web-based classroom students get the opportunity to learn more about a wide variety of topics – ranging from climate change, sustainable consumption to social inclusion. A special focus rests on the Danube Region. The courses are suitable for the agegroup from 15 years on. In Baden-Württemberg the project “eSchool4S” is supported by the Ministry of Education, Youth and Sports.
Programm: Sustainability - Nachhaltigkeit
Weitere Infos und Anmeldung: eSchool4s Infoseite
Dossiers der Landeszentrale für politische Bildung

Klimawandel
Hilft das Pariser Abkommen?
198 Staaten einigten sich 2015 in Paris auf einen Vertrag, der den Klimawandel aufhalten soll. Laut Vertrag soll die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden. Was ist der Klimawandel? Und wie will die Weltgemeinschaft die schlimmsten Folgen abwenden? Das Dossier klärt Grundsatzfragen rund ums Klima.
mehr

Klimaflucht
Migration in Zeiten des Klimawandels und im Schatten von Corona
Immer mehr Menschen sind schon heute gezwungen, ihre Heimat wegen der Auswirkungen des sich verändernden Klimas zu verlassen. Doch was versteht man unter Umweltflüchtlingen? Genießen sie einen besonderen Schutz? Wie viele sind es, woher kommen und wohin gehen sie? Und wie sollte die internationale Völkergemeinschaft helfen? Unser Dossier gibt Antworten.
mehr

Nachhaltigkeit
Definition, Agenda 2030, Nachhaltigkeitsziele und -strategien
Mit der Agenda 2030 möchte die Weltgemeinschaft eine ökonomisch, sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung voranbringen. Aber was ist Nachhaltigkeit überhaupt? Welche Dimensionen von Nachhaltigkeit gibt es? Und was wird weltweit, national und lokal für eine nachhaltige Entwicklung getan? Einen Überblick bietet dieses Dossier.
mehr

17 SDGs: Ziele für nachhaltige Entwicklung
Agenda 2030: Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen
Seit 2016 gilt die Agenda 2030, in der sich die Weltgemeinschaft 17 Ziele für eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entwicklung gesetzt hat. Bis 2030 sollen die sogenannten Sustainable Development Goals, kurz: SDGs, erreicht sein. Was sind die Ziele? Wie weit ist die internationale Staatengemeinschaft in der Umsetzung? Und wo steht Deutschland? Unser Dossier bietet einen Überblick.
mehr

Plastikmüll
Wie gefährlich sind Kunststoffabfälle für uns und unsere Umwelt?
Die Verschmutzung unserer Umwelt mit Plastikmüll ist eines der größten Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts. Wie problematisch ist Plastikmüll? Was macht die Bundesregierung dagegen, was passiert auf europäischer und internationaler Bühne? Und wie kann jede:r Einzelne Plastik reduzieren? Unser Dossier gibt Antworten.
mehr

Unsere Umwelt
5. Juni: Weltumwelttag
Die Vereinten Nationen riefen den Tag 1974 ins Leben, um das weltweite Bewusstsein und Handeln zum Schutz unserer Umwelt zu fördern. Anlässlich des Weltumwelttages zeigen Teilnehmende des Freiwilligen Ökologischen Jahres positive Beispiele, wie Umweltschutz gelingt und wie sie sich täglich für den Umweltschutz einsetzen.
mehr
Wasser
Eine knappe Ressource
Wasser ist die Grundlage des Lebens, ein Lebensraum, eine Energiequelle und ein Wirtschaftsfaktor. Wir nutzen Wasser nicht nur für unsere Ernährung, sondern auch für unsere Hygiene. Doch der Druck auf die knappe Ressource nimmt zu und der lebenswichtige Rohstoff birgt erhebliches politisches Konfliktpotential.
mehr

Greenwashing
Was ist Greenwashing und wie kann man es erkennen?
Hinter „Greenwashing“ verbirgt sich eine Marketingstrategie, mit denen sich Unternehmen ökologischer darstellen möchten als sie es in Wirklichkeit sind. In welchen Branchen ist Greenwashing zu finden? Mit welchen Tricks arbeiten Unternehmen für ihr „grünes“ Image? Und wie lässt sich Greenwashing enttarnen? Einen Überblick bietet unser Dossier.
mehr
Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Dezember 2023.






