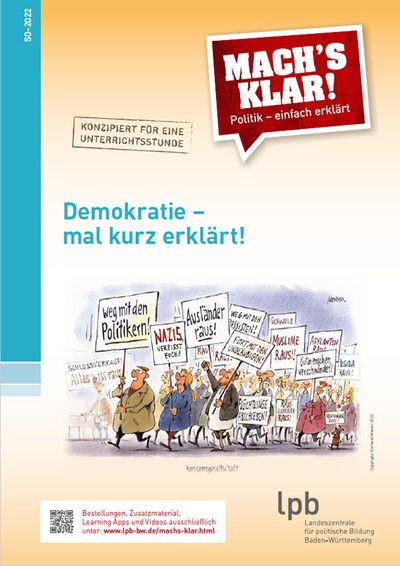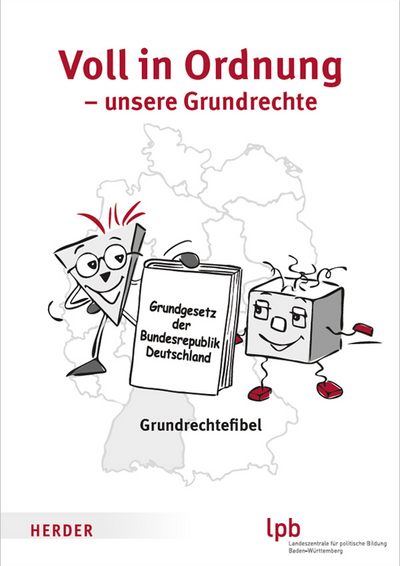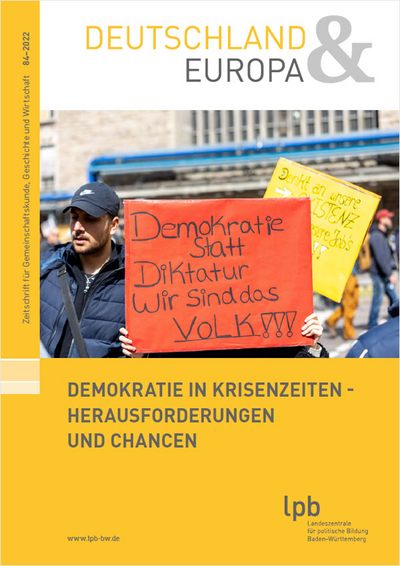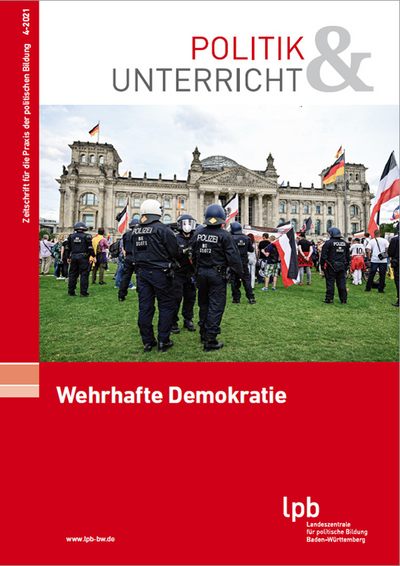Verfassungsorgane in Deutschland

Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundespräsident und Bundesverfassungsgericht – was zeichnet die wichtigsten Institutionen der Demokratie in Deutschland aus? Diese Seite gibt einen Überblick über die Verfassungsorgane der Bundesrepublik. Wie wirken sie zusammen, damit unsere Demokratie funktioniert? Wie schützen sie unsere Demokratie?
Definition: Was sind Verfassungsorgane?
Verfassungsorgane, auch Staatsorgane, sind die obersten Organe eines Staates, die in einer Verfassung vorgesehen sind.
„Den Begriff ‚Organ‘ kennen wir vom menschlichen Körper. Leber, Niere, Herz und Lunge sorgen gemeinsam dafür, dass der Körper gut funktioniert. Auch der Staat hat Organe. Jedes einzelne Organ, aber auch alle gemeinsam, müssen gut arbeiten, damit der Staat funktioniert.“ (Quelle: Hanisauland).
Fünf ständige Verfassungsorgane

Das Grundgesetz (GG) ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Darin ist der institutionelle Aufbau unseres Staates geregelt. Festgelegt sind hier auch die Aufgaben der wichtigsten Institutionen – auch Verfassungsorgane genannt.
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es fünf ständige Verfassungsorgane, die es konstant geben muss:
- Deutscher Bundestag (Art. 38 bis 48 GG)
- Bundesrat(Art. 50 bis 53 GG)
- Bundesregierung(Art. 62 bis 69 GG)
- Bundespräsident(Art. 54 bis 61 GG)
- Bundesverfassungsgericht(Art. 92 bis 104 GG zur Rechtsprechung)
Darüber hinaus gibt es zwei nichtständige Verfassungsorgane, die nur zu bestimmten Zwecken zusammenkommen:
- Bundesversammlung (Artikel 54 GG)
- Gemeinsamer Ausschuss (Artikel 53a GG)
Alle Verfassungsorgane müssen sich an das Grundgesetz als Basis ihres Handelns halten. Dazu gehören selbstverständlich auch die Grundrechte in Artikel 1 bis 19. Damit diese Grundrechte respektiert und umgesetzt werden können, muss sichergestellt werden, dass der Staatsaufbau diese Rechte unterstützt. Dies gelingt durch die Staatsstrukturprinzipien.
Staatsstrukturprinzipien
Staatsstrukturprinzipien sind Prinzipien, die die Grundlagen für staatliches Handeln legen und an denen sich die Verfassungsorgane orientieren müssen. Sie sind in Artikel 20 GG zu finden. Zu diesen Prinzipien gehört, dass die Bundesrepublik Deutschland
- eine Demokratie,
- eine Republik,
- ein Rechtsstaat,
- ein Bundesstaat und
- ein Sozialstaat ist.
Aufgrund der sogenannten Ewigkeitsgarantie gemäß Art. 79 Abs. 3 GG sind die Staatsstrukturprinzipien unabänderlich. Auch mit einer Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten im Bundestag, die sonst für eine Verfassungsänderung notwendig ist, können diese Prinzipien nicht geändert werden (Quelle: Rechtswissenschaft verstehen).
Artikel 20 des Grundgesetzes
(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
Demokratie
Demokratie
Das Demokratiegebot besagt, dass die gesamte Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Es herrscht also Volkssouveränität. Das Volk übt seine Staatsgewalt indirekt über Vertreterinnen und Vertreter (Repräsentanten) aus, die durch Wahlen bestimmt werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist also eine repräsentative Demokratie, in der die Interessen der Allgemeinheit von einer kleinen Gruppe – den Abgeordneten – stellvertretend wahrgenommen werden.
Die Wahlen für alle Parlamente in der Bundesrepublik sind geheim, allgemein, unmittelbar, frei und gleich (Wahlgrundsätze). Unabdingbar für Wahlen und die politische Willensbildung sind die Parteien nach Artikel 21 des Grundgesetzes.
Republik
Republik
Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Republik, in der das Staatsoberhaupt gewählt wird und auf Zeit herrscht. Im Gegensatz dazu wird in einer Monarchie das Staatsoberhaupt durch familien- oder erbrechtliche Regelungen bestimmt und die Herrschaft gilt auf Lebenszeit.
Rechtsstaat
Rechtsstaat
Das Rechtsstaatsprinzip besagt, dass alle staatlichen Behörden in ihrem Handeln an Gesetze gebunden sind, sowohl an die Verfassung, also das Grundgesetz, als auch an andere Gesetze wie etwa das Bürgerliche Gesetzbuch oder das Strafgesetzbuch. Das Rechtsstaatsprinzip schützt und sichert somit die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger vor dem Staat. Staatliche Willkür soll dadurch ausgeschlossen werden.
Durch die Gewaltenteilung ist die Staatsgewalt zudem auf mehrere Schultern verteilt. Die gesetzgebende Gewalt (Legislative), also der Deutsche Bundestag und der Bundesrat, verabschieden Gesetze. Die ausführende Gewalt (Exekutive), also die Bundesregierung, die Ministerien und nachgeordnete Behörden, setzen diese Gesetze um. Die rechtsprechende Gewalt (Judikative), unabhängige Richterinnen und Richter, wachen über die Legislative und Exekutive und schauen danach, dass die Verfassung und andere Gesetze eingehalten werden.
Bundesstaat
Bundesstaat
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Bundesstaat. Der Staat ist also föderal aufgebaut. Das bedeutet, dass die 16 deutschen Länder zusammen einen Bundesstaat bilden – mit gemeinsamer Regierung und gemeinsamen Gesetzen. Die Bundesrepublik Deutschland besteht als aus einem Gesamtstaat (Bundesebene) und seinen Bundesländern (Länderebene).
Die Bundesländer besitzen Staatsqualität, haben zum Beispiel eine eigene Landesverfassung und eigene Parlamente. Die Länder verfügen also auch über Staatsgewalt und können in bestimmten Bereichen, z. B. in Bildungsfragen oder beim Polizeiwesen, selbst entscheiden. Außerdem haben die Bundesländer Mitbestimmungsrechte bei der Gesetzgebung im Bund. Über den Bundesrat sind die Länder an der Gesetzgebung beteiligt und können dadurch Landesinteressen auf Bundesebene durchsetzen. Hier spricht man auch von vertikaler Gewaltenteilung.
Sozialstaat
Sozialstaat
Das Sozialstaatsprinzip verlangt vom Staat, für die Herstellung und Erhaltung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit zu sorgen. Der Staat muss seinen Einwohnerinnen und Einwohnern ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, sie bei wechselnden Lebenslagen absichern und vor Armut oder sozialer Ausgrenzung schützen. Dazu gehören etwa gleiche Bildungschancen für Kinder, gesellschaftliche Teilhabe für alle und Hilfe in privaten Notlagen wie etwa beim Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch die rechtliche Gleichstellung von Frau und Mann.
Deutscher Bundestag

Der Bundestag ist die Erste Kammer des Parlaments der Bundesrepublik Deutschlands. Er tagt seit 1999 im Reichstagsgebäude in Berlin. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind nach Art. 38 GG Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nicht an Aufträge und Weisungen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.
Der Deutsche Bundestag wird als einziges Bundesorgan unmittelbar vom Volk gewählt. Die Abgeordneten werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für jeweils vier Jahre gewählt. Alle Wahlberechtigten haben zwei Stimmen: eine Erststimme zur Wahl eines Kandidierenden im eigenen Wahlkreis und eine Zweitstimme zur Wahl der Landesliste einer Partei. Die Zweitstimmenanteile bestimmen die Sitzverteilung im Bundestag.
Der Bundestag besteht aus mindestens 598 Abgeordneten. Aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten ist die Zahl der Parlamentsmitglieder in der Regel aber höher.
Bundestagspräsident:in
An der Spitze des Bundestages steht die Bundestagspräsidentin oder der Bundestagspräsident. Nach der Verfassung ist das Amt der Bundestagspräsidentin nach dem des Bundespräsidenten und noch vor dem des Bundeskanzlers das zweithöchste Amt in der Bundesrepublik. Die Bundestagspräsidentin vertritt den Bundestag nach außen, leitet die Plenarsitzungen und übt das Hausrecht aus.
Welche Aufgaben hat der Bundestag?
Die wichtigsten Aufgaben des Bundestags sind:
- Alle vier Jahre wird der Bundestag neu gewählt. Der neue Bundestag wählt dann eine Bundeskanzlerin oder einen Bundeskanzler.
- Der Bundestag ist das wichtigste Organ der Gesetzgebung (Legislative) auf Bundesebene.
- Das Recht, die Ausgaben und Einnahmen des Bundes zu kontrollieren (Budgetrecht), gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Bundestags.
- Nach dem Prinzip der Gewaltenteilung kontrolliert der Bundestag (Legislative) die Bundesregierung (Exekutive).
Weiterführende Links
Weiterführende Links
- LpB BW: Portal zur Bundestagswahl mit weiteren Infos zum Bundestag
- Webseite des Deutschen Bundestags
- Kuppelkucker.de: Angebot des Bundestags für Kinder
- mitmischen.de: Angebot des Bundestags für Jugendliche
- BpB: Lexikon: Bundestag
- HanisauLand - Politik für Kinder: Bundestag
- BpB: Spicker - der Deutsche Bundestag
- Planet Schule: der Bundestag
Bundesrat

Der Bundesrat ist die Zweite Kammer des Parlaments in der Bundesrepublik Deutschland und das Verfassungsorgan, durch das „die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union“ mitwirken (Art. 50 GG).
In den Bundesrat kann man nicht gewählt werden: Man wird in die Länderkammer bestellt. Mitglied kann nur werden, wer im Kabinett einer Landesregierung Stimmrecht hat. Der Bundesrat ist also eine Versammlung von Mitgliedern der Landesregierungen (Art. 51 Abs. 1 GG). Insgesamt sind die deutschen Länder im Bundesrat mit 69 ordentlichen Mitgliedern (und Stimmen) vertreten. Aus Baden-Württemberg sitzen sechs Vertreterinnen und Vertreter im Bundesrat und wirken dort an der Gesetzgebung des Bundes mit.
Welche Aufgaben hat der Bundesrat?
- Der Bundesrat wirkt an der Gesetzgebung des Bundes mit. Viele Gesetze können nur dann in Kraft treten, wenn der Bundesrat ihnen ausdrücklich zustimmt.
- Der Bundesrat kann gegen jedes vom Bundestag verabschiedete Gesetz ein Veto einlegen. Bei manchen Gesetzen kann der Bundestag dieses Veto dann überstimmen („Einspruchsgesetz“), bei anderen Gesetzen hat er ein absolutes Vetorecht („Zustimmungsgesetze“). Kommt es zu zwischen Bundestag und Bundesrat zu keiner einvernehmlichen Lösung bei einem Gesetzesvorhaben, wird der Vermittlungsausschuss angerufen. Er besteht aus 16 Mitgliedern des Bundesrates und 16 Mitgliedern des Bundestags (benannt nach Fraktionsstärke).
- Der Bundesrat wirkt an der Verwaltung des Bundes mit. Bestimmten Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften muss er seine Zustimmung erteilen.
- Der Bundesrat verfügt über besondere Mitwirkungsrechte im Falle von äußeren und inneren Krisensituationen. Außerdem hat er verschiedene Ernennungs- und Nominierungsrechte (z. B. bei der Wahl der Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichtes).
- Mit der zunehmenden europäischen Integration gewinnt auch die Mitwirkung des Bundesrates in Angelegenheiten der Europäischen Union (EU) an Bedeutung. Seine Rechte reichen von einem umfassenden Informationsanspruch über die Möglichkeit, Stellungnahmen zu allen EU-Vorlagen abzugeben, die Länderinteressen berühren, bis zur Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in den Rat der Europäischen Union.
Weiterführende Links
Bundesregierung

Die Bundesregierung, auch Bundeskabinett genannt, führt die Geschäfte des Staates. Sie ist das oberste Bundesorgan der vollziehenden Gewalt (Exekutive) und führt diejenigen Gesetze aus, die der Bundestag beschließt. Nach Artikel 62 GG setzt sich die Bundesregierung aus dem Bundeskanzler bzw. der Bundeskanzlerin sowie den Bundesministerinnen und Bundesministern zusammen.
Bundeskanzler:in
Der Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin wird vom Bundestag gewählt. Die Bundesrepublik wird häufig auch als „Kanzlerdemokratie" bezeichnet, weil das Grundgesetz dem Amt des Bundeskanzlers eine starke Stellung mit vielen Befugnissen verleiht. Der Kanzler bzw. die Kanzlerin ...
- bestimmt die Richtlinien der Politik und ist dafür verantwortlich
- legt die Größe des Kabinetts fest
- wählt die Bundesministerinnen und Bundesminister aus. Er oder sie entscheidet auch über seine Stellvertreterung (Artikel 69 GG)
- muss einverstanden sein, wenn ein:e Bundesminister:in das Amt verliert
- leitet die Geschäfte der Bundesregierung
- hat im Verteidigungsfall den Oberbefehl über die Bundeswehr
- kann während der Legislaturperiode nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt werden
- kann im Bundestag die Vertrauensfrage stellen.
Bundesminister:innen
Die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler schlägt die Bundesminister:innen vor, die dann wiederum vom Bundespräsidenten ernannt werden. Die Bundesminister:innen leiten ihr Ministerium selbständig und eigenverantwortlich. Der Bundeskanzler besitzt jedoch ein Weisungsrecht gegenüber den Ministern und Ministerinnen.
Welche Aufgaben hat die Bundesregierung?
Als ausführende Gewalt (Exekutive) werden der Bundesregierung vor allem folgende Aufgabenbereiche zugeordnet:
- Sie setzt den politischen Willen der parlamentarischen Mehrheit in praktische Politik um.
- Sie hat das Recht, Gesetzesvorlagen in den Bundestag einzubringen.
- Sie ist verantwortlich für die Verwirklichung der Gesetze, die vom Bundestag und Bundesrat beschlossen wurden.
- Sie bietet Lösungen für aktuelle Probleme durch eigene Gesetzesvorschläge.
- Sie gestaltet die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland.
Weiterführende Links
Weiterführende Links
- LpB BW: Portal zur Bundestagswahl mit weiteren Infos zur Bundesregierung
- LpB BW: Portal zur Bundestagswahl mit weiteren Infos zum Bundeskanzler
- Webseite der Bundesregierung
- Webseite des Bundeskanzlers
- BpB: Lexikon: Bundesregierung
- HanisauLand - Politik für Kinder: Bundesregierung
- BpB: Spicker - Die Bundesregierung
- Planet Schule: Die Bundesregierung
Bundespräsident

Die Bundespräsidentin bzw. der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland. Sie bzw. er hat die Aufgabe, das Grundgesetz zu schützen, die Bundesrepublik Deutschland nach innen und außen zu repräsentieren, den Föderalismus zu fördern und durch ihre bzw. seine Überparteilichkeit Gesamtdeutschland zu einen. Im Vergleich zur Weimarer Republik wurde der Einfluss des Bundespräsidenten im Grundgesetz stark eingeschränkt: Die Aufgaben in diesem höchsten Amt in der Bundesrepublik sind verfassungsrechtlich umschrieben, insgesamt aber eher repräsentativer Natur.
Die Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten. Dies ist einziger Zweck der Bundesversammlung. Eine Amtszeit des Bundespräsidenten dauert fünf Jahre. Eine anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig.
Seit 1994 ist das Schloss Bellevue in Berlin der erste Amtssitz des Bundespräsidenten.
Welche Aufgaben hat der Bundespräsident?
Viele wichtige Aufgaben kann der Bundespräsident nicht im Alleingang, sondern nur im Zusammenwirken mit anderen politischen Organen wahrnehmen:
- So schlägt er nach Bundestagswahlen dem Bundestag einen Kandidaten zur Wahl als Bundeskanzler vor.
- Bei der Ernennung von Ministerinnen und Ministern muss der Bundespräsident dem Vorschlag des Bundeskanzlers folgen. Dies gilt auch bei der Ernennung von Bundesrichter:innen, Bundesbeamt:innen und Offizier:innen.
- Der Bundespräsident kann auf Vorschlag des Bundeskanzlers den Bundestag auflösen, wenn der Bundestag dem Bundeskanzler zuvor das Vertrauen verweigert hat („Vertrauensfrage“).
- Er unterzeichnet und verkündet Gesetze. Er kann Gesetze auch ablehnen, wenn sie nach seiner Überzeugung zweifelsfrei gegen die verfassung verstoßen.
- Der Bundespräsident übernimmt die Repräsentation der Bundesrepublik Deutschland nach innen und außen.
- Er hat die völkerrechtliche Vertretung der Bundesrepublik Deutschland inne und schließt zum Beispiel Verträge mit auswärtigen Staaten ab.
- Der Bundespräsident hat das Begnadigungsrecht in Fällen inne, wo das Urteil von einem Bundesgericht gefällt wurde.
- Außerdem obliegt ihr oder ihm das Ordensrecht des Bundes.
Bundesverfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht mit Sitz in Karlsruhe ist das höchste Gericht in Deutschland. Es kümmert sich darum, dass in Deutschland die Verfassung, also das Grundgesetz, eingehalten wird und die Gesetze den Regeln unserer Verfassung entsprechen. Daher wird das Bundesverfassungsgericht auch „Hüter der Verfassung“ genannt. Es ist das Verfassungsgericht des Bundes. Auch jedes Bundesland hat ein eigenes Landesverfassungsgericht.
Gegenüber anderen hohen Verfassungsorganen wie dem Bundestag, der Bundesregierung oder dem Bundesrat ist das Bundesverfassungsgericht unabhängig. Es ist Teil der judikativen Staatsgewalt, also der rechtsprechenden Gewalt.
16 Richterinnen und Richter gehören dem Bundesverfassungsgericht an. Sie sind in zwei gleichberechtigte Kammern, sogenannte Senate, aufgeteilt. Meist entscheidet der Erste Senat über Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürgerschaft und Staat; der Zweite Senat kümmert sich vorzugsweise um Angelegenheiten zwischen Staatsorganen, wie zum Beispiel Kompetenzstreitigkeiten zwischen Bund und Ländern.
Ein Richter bzw. eine Richterin wird für eine Amtszeit von zwölf Jahren gewählt, eine anschließende Wiederwahl ist nicht möglich. Gewählt werden die Frauen und Männer je zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat. Für die Wahl ist mindestens eine Mehrheit von zwei Dritteln aller Wahlstimmen nötig.
Welche Aufgaben hat das Bundesverfassungsgericht?
Das Grundgesetz regelt in Artikel 93 und weiteren Artikeln eine Vielzahl von Fällen, in denen das Bundesverfassungsgericht angerufen werden kann. Die drei wichtigsten Verfahrensarten betreffen Bürgerinnen und Bürger, andere Gerichte und staatliche Organe.
- So kann jeder Bürger und jede Bürgerin eine Verfassungsbeschwerde erheben, der oder die sich durch ein Gesetz, eine Maßnahme der Verwaltung oder durch die Entscheidung eines Gerichts in ihren Grundrechten verletzt glaubt.
- Gerichte können das BVerfG anrufen, wenn sie Gesetze für verfassungswidrig halten.
- Auch können zwischenstaatliche Organe bei Meinungsverschiedenheiten über ihre Rechte und Pflichten „Karlsruhe“ anrufen.
- Wenn staatliche Akteure vorsätzlich das Grundgesetz verletzen, kann das BVerfG auch Parteien verbieten sowie Richterinnen und Richter oder sogar den Bundespräsidenten entlassen.
Weiterführende Links
Nichtständige Verfassungsorgane
Bundesversammlung
Die Bundesversammlung ist die größte parlamentarische Versammlung der Bundesrepublik, deren einziger Zweck es ist, das Amt des Bundespräsidenten zu wählen. Daher kommt die Bundesversammlung in der Regel nur alle fünf Jahre zu dieser Wahl zusammen. Die Bundestagspräsidentin oder der Bundestagspräsident hat den Vorsitz der Bundesversammlung inne.
Die Bundesversammlung besteht aus den Mitgliedern des Deutschen Bundestags und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den Landtagen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden. Wie viele Delegierte ein Bundesland schicken darf, hängt von der Bevölkerungszahl ab. Und je größer eine Landtagsfraktion ist, desto mehr Delegierte kann sie in die Bundesversammlung entsenden. Die Vertreterinnen und Vertreter der Länder müssen keine Landtagsabgeordnete oder Politiker:innen sein.
Die paritätische Beteiligung der Länderparlamente soll bewirken, dass das Staatsoberhaupt die Bundesrepublik mit ihrer Gliederung in Bund und Länder repräsentiert.
Weiterführende Links
Gemeinsamer Ausschuss
Der Gemeinsame Ausschuss ist das Notparlament im Verteidigungsfall, wenn dem rechtzeitigen Zusammentreten des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen.
Der Gemeinsame Ausschuss besteht aus 48 Mitgliedern. 32 davon (zwei Drittel) werden vom Bundestag nach Größe der Fraktionen bestimmt. 16 weitere (ein Drittel) sind Mitglieder des Bundesrats (pro Bundesland ein Mitglied).
LpB-Publikationen zum Thema
MK 50-2022 Demokratie – mal kurz erklärt!
Mach´s klar! 50-2022:
Politik - Einfach erklärt
Stuttgart 2023
Voll in Ordnung – unsere Grundrechte (Grundrechte Fibel)
Bestellungen sind nur aus Baden-Württemberg möglich
Grundrechtefibel (Grundgesetz-Wissen) für Kinder ab 8 Jahren; für Grundschulen, SBBZ und weiterführende Schulen
(7. Auflage 2022)
Stuttgart 2025
D&E 84-2022 Demokratie in Krisenzeiten – Herausforderungen und Chancen
Herausforderung und Chancen
Heft 84-2022
Stuttgart 2022
Angebote der Landeszentrale für politische Bildung
Online-Grundkurs: Demokratie in Deutschland
Der Grundkurs „Demokratie in Deutschland“ ist selbstständig und ohne tutorielle Begleitung nutzbar. Er informiert über die Wesensmerkmale der Demokratie am Beispiel der Bundesrepublik. In der Tour 2 erfährt man alles über die Organe in Deutschland.
zum Kursraum
Programm (PDF)
Autor: Internetredaktion LpB BW | letzte Aktualisierung: Oktober 2023