Juni 2014

Klara-Marie Faßbinder (1890-1974) – Pädagogin und Kämpferin für den Frieden auf der Welt
„Wir müssten von einem Nebeneinander zu einem Miteinander und schließlich Füreinander kommen“ – dieses Fazit zieht Klara-Marie-Faßbinder, die aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs heraus zur glühenden Pazifistin geworden war. Bereits während der Weimarer Republik bekommt die Lehrerin deshalb Schwierigkeiten und wird von den Nationalsozialisten wegen ihres Einsatzes gegen antisemitische Tendenzen fristlos aus dem Amt entlassen.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wird Klara-Marie-Faßbinder Professorin für Geschichte an der Pädagogischen Akademie in Bonn. Aber schon 1953 wird sie aufgrund ihrer Friedensaktivitäten erneut vom Dienst suspendiert und 1955 in den "Ruhestand" versetzt. Beide Regime fürchteten den Einfluss der Lehrerin auf ihre Schülerinnen, weil sie unverblümt ihre Meinung vertrat. Klara-Marie-Faßbinder kämpfte bis an ihr Lebensende, fest davon überzeugt, dass das, was sie tat, richtig war.
Wer war diese beinahe vergessene Aktivistin, deren Tod sich am 4. Juni 2014 zum 40. Male gejährt hat?
Kindheit, Jugend und Studium
Klara Marie Faßbinder wird am 15.2.1890 in Trier in eine katholische, vaterländische und kaisertreue, aber für soziale und politische Fragen aufgeschlossene Lehrerfamilie hineingeboren. Sie soll "etwas Ordentliches lernen und sich auf eigene Füße stellen können" (Quelle: Klara Marie Fassbinder, Begegnungen und Entscheidungen, Darmstadt 1961.) Nach dem Besuch des Lehrerinnenseminars in Koblenz erwirbt sie im März 1913 in Münster das Abitur. Danach wird sie eine der ersten weiblichen Studierenden an der Bonner Universität. Oftmals ist sie in den Lehrveranstaltungen die einzige Frau.
Die Studienjahre in Bonn beschreibt Klara Marie Faßbinder als eine Zeit der inneren Kämpfe und Klärung. Sie bekommt den ungeheuren "Klassendünkel" akademischer Kreise zu spüren: Nachdem seit 1908 Frauen zum Studium zugelassen waren, sind Männer zwar bereit, den geschulten Verstand von Frauen zu bewundern – gleichzeitig ist für sie aber eine Frau, die sich durch ihr Studium einen eigenständigen Broterwerb verspricht, nicht mehr gesellschaftsfähig und wird als „Blaustrumpf“ diffamiert. Klara Marie Faßbinder wirft diesen Akademikern vor, dass für sie die Unterdrückung der unteren sozialen Schichten ebenso selbstverständlich sei wie die Abhängigkeit der Frauen von den Männern. Forderungen nach einer größeren Beteiligung von Frauen in der Politik hält sie jedoch für unbegründet, der Kampf ums Frauenwahlrecht ist nicht ihr Handlungsfeld. Faßbinder genügt es, wenn Frauen im geistigen und im sozialen Leben Entscheidungen treffen können.
Nachdem Klara Marie Faßbinder 1917 an der Universität Bonn das Staatsexamen für das höhere Lehramt in Deutsch, Französisch, Geschichte und Philosophie abgelegt hat, absolviert sie ihre Referendarinnenzeit in Bonn und Köln. Der erste Weltkrieg bewegt sie leidenschaftlich und sie ist von der Idee erfüllt, Frauen müssten mithelfen, den “Endsieg Deutschlands” zu erringen.
Kriegsfolgen: Von der Nationalistin zur Pazifistin
Unter dem Eindruck des tatsächlichen Kriegsgeschehens ändert sich diese Ansicht Klara Marie Faßbinders gründlich. 1918 lernt sie die Schlachtfelder aus der Nähe kennen und bekommt Einblick in die „Männersache“ Politik. Freiwillig und voller Überzeugung zieht sie in den Dienst der kaiserlichen Armee und erteilt den Männern des dritten Hauptquartiers südlich von Sedan "vaterländischen Unterricht", um die Moral der Truppe zu stärken.
Die Schrecken und Grausamkeiten des Krieges prägen die junge Frau jedoch nachhaltig und bestimmen die Richtung ihres weiteren Lebens. Der Krieg, so erkennt sie, ist etwas, das dem hohen Stand der menschlichen Entwicklung nicht entsprechen, mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist und niemals Mittel zur Konfliktlösung sein kann.
Von der glühenden Nationalistin wird Klara Marie Faßbinder zur entschiedenen Pazifistin. Sie muss erfahren, wie tragisch und abscheulich es ist, für das "Vaterland" zu sterben. Von der Idee vom "Erbfeind Frankreich" will sie künftig nichts mehr wissen. Und: die "gefährdete Sache" des Friedens soll fortan nicht mehr den Berufspolitikern alleine überlassen bleiben. Das Eiserne Kreuz, das ihr 1919 verliehen werden soll, lehnt Klara Marie Faßbinder ab. Es passe nicht zu einer "miles pacis", einer Kämpferin für den Frieden. Faßbinder fragt sich später oft, wie sie so lange hatte blind sein können.
Nach Kriegsende kehrt die 28jährige an die Bonner Universität zurück und promoviert 1919 in Philosophie. Ihre Unterrichtstätigkeit führen sie an eine private Mädchenschule in Bonn und ein Saarbrücker Lyzeum. Als Klara Marie Faßbinder 1921 die Landesgeschäftsführung des Bühnenvolksbundes, einer Vereinigung der christlichen Volksbühnenbewegung, angetragen wird, zögert sie nicht lange, diese zu übernehmen. Zum ersten Mal kommt sie hier mit der arbeitenden Klasse in Berührung und lernt den Zusammenhang zwischen materieller Not und mangelnden Bildungsmöglichkeiten kennen.
Klara Marie Faßbinder besucht nun verschiedene Friedenkongresse, als ersten 1923 den Internationalen Friedenskongress in Freiburg/Breisgau. Auf dem großen internationalen Frauenstimmrechtskongress 1926 in Paris wird sie in den neu gegründeten Friedensausschuss gewählt und findet Kontakt zur internationalen Frauenbewegung. Mit den Aktivitäten dieser Frauen verknüpft sie zukünftig ihre politische Arbeit. Sie wird Mitarbeiterin der Zeitschrift "Die Frau" und kämpft fortan auch für gleiche Rechte zwischen den Geschlechtern.
Ist Klara Marie Faßbinder schon aufgrund ihres pazifistischen Engagements während der Weimarer Republik ab 1933 für die nationalsozialistischen Machthaber nicht tragbar, so umso weniger, als sie auch nach der Machtübernahme ihre abweichende weltanschauliche Meinung deutlich zu verstehen gibt (Vgl. dazu: Gisela Notz, "Wie eine Fliege im Spinnennetz". Klara Marie Faßbinder 1890-1974, in: Annette Kuhn (Hg.), Frauenleben im NS-Alltag, Pfaffenwei-ler 1994, S. 29 - 38.).
Zurückgekehrt von einer Reise nach China und Japan wird sie 1933 vorübergehend von ihrer Stelle suspendiert und 1935 schließlich endgültig entlassen, weil sie sich zum wiederholten Male öffentlich gegen antijüdische Übergriffe erklärt hat.
Faßbinders Wunsch, an einer deutschen Schule in Shanghai zu unterrichten, zerschlägt sich, weil die Nationalsozialisten sie mit Berufsverbot für öffentliche Schulen bestrafen. 1940 wird sie Leiterin einer katholischen Mädchenrealschule in Horrem bei Bonn. Sie versucht nun, die junge Generation durch christliche Bildungsarbeit vor den “Irrlehren” des Nationalsozialismus zu bewahren. Da sie aus ihrer politischen Einstellung keinen Hehl macht, ist sie Schikanen durch die Gestapo ausgesetzt. Nachdem ‚ihre‘ Schule durch die Nazis geschlossen wird, erteilt Faßbinder Nachhilfestunden. Den Ratschlag französischer Freunde, ins Exil nach Frankreich zu gehen, schreibt sie in den Wind. Sie hofft, dass der Spuk bald vorbei ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg – die neue Republik
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kehrt Klara Marie Faßbinder an die Mädchenschule in Horrem zurück und wird gleichzeitig Professorin für Geschichte an der Pädagogischen Akademie in Bonn. Nun – so scheint es – wird ihr aufrechter Gang gewürdigt. Einer dienstlichen Beurteilung aus dem Jahre 1949 ist zu entnehmen:
"Sie ist eine wissenschaftlich, pädagogisch und charakterlich sehr hochstehende Persönlichkeit, die auch im Dritten Reich ihr Möglichstes getan hat, die Jugend von den schlechten Einflüssen des Nationalsozialismus fernzuhalten”. |
Fassbinder vermittelt den Studierenden ein genaues Bild der jüngsten Vergangenheit, erörtert mit ihnen, wie es zur nationalsozialistischen Herrschaft kommen konnte und diskutiert mit ihnen, was zu tun sei, um eine Wiederholung zu verhindern.
Ende der 1940er Jahre schließt sich Faßbinder unter dem Eindruck der zunehmenden Ost-West-Konfrontation und der Politik Remilitairiserung der Regierung Adenauer der Friedens-bewegung an. Auf vielen Veranstaltungen setzt sie sich gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, für eine friedliche Verständigung der Staaten, für die Aussöhnung mit dem Osten und die Wiedervereinigung ein. Auf (Frauen)Kongressen, Versammlungen, bei Vorträgen und in Artikeln warnt sie vor Adenauers „Politik der Stärke“.
Fassbinder wird eine der Aktivistinnen, die 1951 zu einem Frauenfriedenskongress gegen die Wiederbewaffnung mobilisieren und im Anschluss daran die “Westdeutsche Frauenfriedensbewegung” (WFFB) als wichtiges überparteiliches Organ des Frauenprotests gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik gründen. In der Westdeutschen Frauenfriedensbewegung, so Elly Steinmann über das Frauen-Netzwerk, „arbeitete die Christin neben der Kommunistin, die Berufstätige mit der Hausfrau, die Wissenschaftlerin mit der Arbeiterin.“( Elly Steinmann zit. nach: www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35283/friedensfrauen-im-westen, erfasst am 15.7.2014.)
Klara Marie Faßbinder gehört der geschäftsführenden Leitung der WFFB an und ab 1952 zur Redaktion der Monatszeitschrift “Frau und Frieden”.
Die Machthabenden entwickeln nun offensichtlich Ängste, die Professorin könnte den StudentInnen ihre Vorstellungen von einer friedlichen Welt nahe bringen. Besonders gefährlich erscheint Klara Marie Faßbinder Spitzeln, die sie beobachten, weil sie "in ihrer Dialektik außerordentlich geschickt" sei und es ihr gelinge, Frauen in verschiedenen gesellschaftlichen Positionen davon zu überzeugen, dass Friedensarbeit das Gebot der Stunde ist.
Beim Frauenfriedenstag am 13.1.1951 in der Frankfurter Paulskirche hält Klara Marie Faßbinder vor rund 1.100 TeilnehmerInnen das Hauptreferat. In einem Spitzelbericht liest sich darüber:
|
Eine Professorin, die Anti-Kriegspolitik betreibt und sich nicht voll auf die Seite der Regierung stellt, erscheint auch in der Nachkriegsrepublik für die Ausbildung von Lehrerinnen offensichtlich ungeeignet.

Der Bildausschnitt zeigt Klara-Marie Faßbinder am Tag der ersten Lesung des „Gesetzentwurf über das Notdienstgesetz“ während einer Rede auf einer Frauen-Protestversammlung am 28.9.1960 im Bonner Bürgerverein. Links von ihr sieht man Irm de Ondarza. Foto: Archiv der deutschen Frauenbewegung, Kassel, NL-P-40
Schließlich wird Klara Marie Faßbinder 1953 auf Basis dubioser Berichte und Denunziationen in einem politischen Verfahren durch die nordrhein-westfälische Kultusministerin Christine Teusch die Lehrbefugnis entzogen. Ein Jahr später, nach langen Auseinandersetzungen, bei denen sich die Beschuldigungen immer wieder als haltlos erweisen, wird Faßbinder endgültig von ihrem Amt suspendiert und gegen ihren Willen, ohne Angabe von Gründen und ohne Rechtsgrundlage bis zur Altersgrenze beurlaubt. (Vgl. auch: Diether Posser, Anwalt im kalten Krieg, Gütersloh 1991, S. 64.)
Kultusminister Werner Schütz will Faßbinder gar auf ihren Geisteszustand überprüfen, weil sie eine “Fanatikerin der Wahrheit” sei. Nicht einmal eine Abschiedsvorlesung wird erlaubt. Die Universität darf Klara Marie Faßbinder trotz massiver Proteste der Studierenden nicht mehr betreten.
Faßbinder widmet sich weiter der Friedenspolitik. Auf dem Fuldaer Katholikentag wird sie 1954 noch einmal bespitzelt und sorgt für Schlagzeilen im Wochenmagazin „Der Spiegel“. Erst im Juni 1957 sorgt der neue nordrhein-westfälische Kultusminister Prof. Paul Luchtenberg dafür, dass Faßbinder rehabilitiert wird.
„Für die geleisteten treuen Dienste werden Frau Professor Dr. Fassbinder Dank und Aner-kennung ausgesprochen” steht nun in ihrer Ruhestandsurkunde.
Die Anschuldigungen nehmen kein Ende
Trotz “aller harten Schläge, die dem Werk des Friedens” für Klara Marie Faßbinder 1956 durch die Einführung der Wehrpflicht für junge Männer zugefügt worden sind, ist ihr christlicher Glaube unerschütterlich. Sie glaubt fest daran, dass der Christengott “den Sturm der Erdendinge” in seinen “friedvollen Händen” ruhen hat. Deutschland solle mit der Abrüstung beginnen und das eingesparte Geld den hungernden Kindern der Welt zur Verfügung stellen, betont sie in Artikeln und Reden.
Fassbinder spricht auf Tagungen in Ost und West und versucht auf zahlreichen Reisen nach England, Südeuropa, Skandinavien, Osteuropa und ins ferne Asien ihre Mission voranzubringen. Sie konferiert mit Kardinal Bea, dem Erzbischof von Posen und Papst Johannes XXIII und setzt sich mit Walter Ulbricht und Nikita Chruschtschow auseinander. Bis ins hohe Alter begleitet Klara Marie Faßbinder mit kritischer Stimme die politischen Entwicklungen in Deutschland und fordert eine umfassende geistige und gesellschaftliche Erneuerung. Die einschneidende Erfahrung der gleichgeschalteten Gesellschaft des Dritten Reiches lässt sie Stellung nehmen gegen polizeistaatliche Entwicklungen und Notstandsgesetze. Ihr unbedingter Pazifismus motiviert sie zum Engagement in der Ostermarsch-Bewegung und zu Protesten gegen den Vietnam-Krieg.
Ihre sozial-humanitäre Gesinnung regt sie an zur Beschäftigung mit den Problemen der „Dritten Welt“.
Aufgrund ihrer Aktivitäten wird Klara Marie Fassbinder weiter hart angegriffen. Auch aus dem ‚eigenen‘ Lager der katholischen Kirche, die sich in der Frage der Wiederbewaffnung und Deutschlandpolitik eng der Linie der Regierung Adenauer angeschlossen hat, kommen schmerzhafte Rippenstöße. Dennoch bleibt Faßbinder ihren Anschauungen treu und arbeitet unermüdlich weiter.
1967 gerät Klara Marie Faßbinder noch einmal in die Schlagzeilen der in- und ausländischen Presse: Bundespräsident Heinrich Lübke weigert sind, ihr den Orden der französischen Regierung "Les Palmes Académiques" zu überreichen, der ihr als Übersetzerin der Werke des französischen Schriftstellers Paul Claudel und für ihre Bemühungen um die deutsch-französische Freundschaft verliehen werden soll. Gründe für seine Haltung nennt Lübke nicht.
Die Frankfurter Rundschau weiß zu berichten, dass “nach Auskunft informierter Kreise” vieles darauf hindeute, “dass der Bundespräsident an den zahlreichen politischen Aktivitäten von Klara-Marie Fassbinder” Anstoß genommen habe.
Im Mai 1967 weigert sich der Rektor der Bonner Universität, ihr Räume für einen Vortrag zur Verfügung zu stellen, der auf Einladung des AStA im Rahmen einer Veranstaltungsreihe mit Referenten aus der Sowjetunion stattfinden soll. Faßbinder hält den Vortrag "Schluss mit Deutschland" daraufhin vor 800 begeisterten StudentInnen in der Mensa der Universität. Die Bonner Studierenden warten jedoch vergeblich auf ein Wort zur ‚Ordensaffäre‘.
Zwei Jahre später, im November 1969, erhält Klara-Marie Fassbinder endlich die Auszeichnung „Les Palmes Académiques“ – aus den Händen des neu gewählten Bundespräsidenten Gustav Heinemann.
Zu ihrem 80. Geburtstag erhält Klara-Marie Faßbinder eine von namhaften AutorInnen gestaltete Festschrift, zu der der Kölner Kardianl Frings das Vorwort schreibt. (Baur, Hannecläre/Fölsing, Günter: Das politische Engagement des Christen heute, Bonn 1970.)ber 1968 im Alter von 80 Jahren in Köln – der Stadt, in der sie fast ihr gesamtes Leben verbracht hat. Wie viele Lehrerinnen und Parlamentarierinnen jener Zeit hat sie nie geheiratet und ist kinderlos geblieben.
Das Ende eines erfüllten Lebens
Klara Marie Fassbinder ist überzeugt von der besonderen politischen Aufgabe von Frauen, für "ein wenig mehr Güte und Verständnis in der Welt" zu sorgen. Ihre Ideen legt sie ebenso selbstverständlich auf großen Kongressen in den Hauptstädten der Welt dar, wie sie auch zu Ausspracheabenden kleiner Frauengruppen in den entlegensten Winkel der Bundesrepublik kommt. Sie resigniert nie, weil sie fest davon überzeugt ist, dass das, was sie tut, das Richtige ist. Und sie passt in keine der Schubladen, in die man sie immer wieder stecken will. Das ist es vor allem, was sie suspekt macht. Einem Reporter sagt die bereits über 80jährige: “Wenn ich es noch mal zu tun hätte, ich würde es nicht anders machen”.
Im Alter von über 80 Jahren nimmt Klara Marie Fassbinder im Mai 1972 Abschied von ihren Engagement in der Westdeutschen Frauenfriedensbewegung. Am 4. Juni 1974 stirbt "die kleine kämpferische Frau" 84jährig in Berkum bei Bonn.
Ihre Weggefährtin Elly Steinmann schreibt nach ihrem Tode:
"Die Geschichte wird Klara Marie Fassbinder den Platz zuerkennen, den man ihr so lange verweigert hat.“ (Elly Steinmann in: Florence Hervé (Hg.), Brot & Rosen, Geschichte und Perspektive der demokratischen Frauenbewegung, Frankfurt/M. 1979, S. 172.)
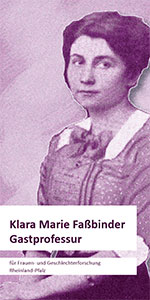 |
Seit 2001 fördert die rheinland-pfälzische Landesregierung mit der „Klara-Marie-Faßbinder-Gastprofessur“ eine internationale und interdisziplinäre Professur zur Frauen- und Geschlechterforschung. |
Juni 2014 (Gisela Notz)
Zitierte Quellen, Literatur und Links
Quellen:
- Faßbinder, Klara Marie: Begegnungen und Entscheidungen, Darmstadt 1961.
- Faßbinder, Klara Marie: Der versunkene Garten, Heidelberg 1968.
Literatur
- Becker, Thomas B.: Klara Maria Fassbinder – Eine Rheinländerin als Mittlerin zwischen Deutschland und Frankreich, in: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein (2011) 214, S. 273-300.
- Hoherz, Hilde: "...ein Ziel, allen Opfers wert". Klara-Marie Faßbinder (1890-1974): Friedens-politikerin für die deutsch-französische Verständigung während der Völkerbundzeit,
in: Annette Keinhorst/Petra Messinger (Hg.), Die Saarbrückerinnen. Beiträge zur Stadtgeschichte,
St. Ingbert 1998, S. 65–88. - Notz, Gisela: Klara Maria Faßbinder, in: Josef Matzerath (Hg.), Bonn. 54 Kapitel Stadtgeschichte, Bonn 1989, S. 371 – 375.
- Notz, Gisela „Unser Fräulein Doktor..., die hat uns immer die Wahrheit gesagt", Klara-Marie Faßbinder zum 100. Geburtstag,
in: beiträge zur feministischen theorie und praxis 27 (1990), S.161–171; hier: S. 162. - Notz, Gisela: "Wie eine Fliege im Spinnennetz". Klara Marie Faßbinder 1890-1974,
in: Annette Kuhn (Hg.), Frauenleben im NS-Alltag, Pfaffenweiler 1994, S. 29 - 38. - Notz, Gisela: Klara Marie Fassbinder (1890–1974), in: Annette Kuhn/Brigitte Mühlen-bruch/Valentine Rothe (Hg.): 100 Jahre Frauenstudien. Frauen der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Dortmund 1996, S. 175 – 179.
- Notz, Gisela: Klara Marie Fassbinder and Womens’s Peace Activities in the 1950s and 1960s,
in: Journal of Women’s History 3 (2001), S. 98-123. - Notz, Gisela: Das friedenspolitische Engagement von Klara Marie Faßbinder (1890-1974),
in: Detlef Bald/Wolfram Wette (Hg.), Alternativen Zur Wiederbewaffnung. Friedenskonzeptionen in Westdeutschland 1945 – 1955, Essen 2008, S. 155 – 170. - Posser, Diether: Anwalt im kalten Krieg, Gütersloh 1991.
- Steinmann, Elly: Die Lehrmeisterin, Klara Marie Faßbinder – Porträt,
in: Florence Hervé (Hg.), Brot & Rosen. Geschichte und Perspektive der demokratischen Frauenbewegung, Frankfurt/M. 1979, S. 170-172.
Link
- Hervé, Florence: Fast vergessen - die Frauenfriedensbewegung in der BRD
www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35283/friedensfrauen-im-westen

