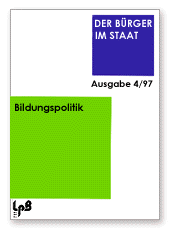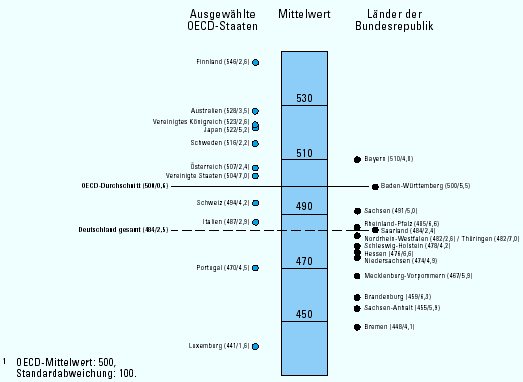Schulstudie PISA I
PISA I schockte 2001 die deutschen Schulpolitiker. Deutsche Schüler hatten beim weltweit größten Schülertest "PISA" (Programme for International Student Assessment) unterdurchschnittlich abgeschnitten. Öffentlichkeit und Medien waren aufs Höchste alarmiert, Kultusminister verfielen in Aktionismus, eine aufgeregte bildungspolitische Grundsatzdebatte hob an.
PISA ist eine international standardisierte Leistungsmessung, die von den Teilnehmerstaaten gemeinsam entwickelt wurde und mit 15-jährigen Schülerinnen und Schülern in ihren Schulen durchgeführt wird. PISA ist ein langfristig angelegtes Projekt, das zunächst drei Erhebungszyklen umfasst. In jedem Zyklus werden die drei Kompetenzbereiche Lesekompetenz (reading literacy), mathematische Grundbildung (mathematical literacy) und naturwissenschaftliche Grundbildung (scientific literacy) untersucht, mit jeweils wechselndem Schwerpunkt.
- Lesekompetenz
Lesekompetenz ist mehr als einfach nur lesen zu können. PISA versteht Lesekompetenz als ein wichtiges Hilfsmittel für das Erreichen persönlicher Ziele, als Bedingung für die Weiterentwicklung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten und als Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Der PISA-Test erfasst, inwieweit Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, geschriebenen Texten gezielt Informationen zu entnehmen, die dargestellten Inhalte zu verstehen und zu interpretieren sowie das Material im Hinblick auf Inhalt und Form zu bewerten. Dabei wird eine breite Palette verschiedener Arten von Texten eingesetzt, die neben kontinuierlichen Texten wie Erzählungen, Beschreibungen oder Anweisungen auch nichtkontinuierliches Material wie Tabellen, Diagramme oder Formulare umfasst.
- Mathematische Grundbildung
Mathematische Grundbildung besteht aus mehr als der Kenntnis mathematischer Sätze und Regeln und der Beherrschung mathematischer Verfahren. Sie zeigt sich vielmehr im verständnisvollen Umgang mit Mathematik und in der Fähigkeit, mathematische Begriffe als Werkzeuge in einer Vielfalt von Kontexten einzusetzen. Hierzu gehören unter anderem ein Verständnis der Rolle, die Mathematik in der heutigen Welt spielt, sowie die Fähigkeit, Situationen in mathematische Modelle zu übersetzen, mathematisch zu argumentieren und begründete mathematische Urteile abzugeben.
- Naturwissenschaftliche Grundbildung
Zur naturwissenschaftlichen Grundbildung gehören ein Verständnis grundlegender naturwissenschaftlicher Konzepte, wie etwa Energieerhalt, Anpassung oder Zerfall, Vertrautheit mit naturwissenschaftlichen Denk- und Arbeitsweisen sowie die Fähigkeit, dieses Konzept- und Prozesswissen vor allem bei der Beurteilung naturwissenschaftlich-technischer Sachverhalte anzuwenden. Dies beinhaltet weiterhin die Fähigkeit, Fragen zu erkennen, die mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht werden können, sowie aus Beobachtungen und Befunden angemessene Schlussfolgerungen zu ziehen.
180.000 Schüler aus 32 Staaten stellten ihr Wissen bei der Schulstudie "PISA" der OECD unter Beweis. Die deutschen Teilnehmer schafften es gerade mal auf Platz 21 - 25, je nach Aufgabengebiet. Besonders im Lesen, Rechnen und den Naturwissenschaften gehören sie zu den schlechtesten.
Die "PISA"-Studie zeigt zudem auf, dass der Schulerfolg in Deutschland wie in keinem anderen Industriestaat abhängig vom Einkommen der Eltern ist.
Blickt man auf die erfolgreichsten Länder - Finnland, Kanada, Neuseeland, Japan -, so fallen bei allen Unterschieden Gemeinsamkeiten auf. Die Schüler verbringen dort wesentlich mehr Zeit in der Schule, und sie werden viel später als in Deutschland nach Leistung getrennt.
Die Beratungsfirma McKinsey forderte auf einer Bildungskonferenz im Juni 2003 in Rostock tief greifende Reformen im deutschen Bildungswesen. Sie monierte: "Seit der Veröffentlichung von PISA ist recht wenig passiert". McKinsey stellte Empfehlungen für eine Schulreform vor. Sie basieren auf einem Modell, in dem Daten von knapp 6000 Schulen und mehr als 155.000 Schüler aus 27 Ländern einflossen:
- Eine der wichtigsten Triebfedern für mehr Bildungserfolg sei es, die institutionelle Trennung der Schüler später zu vollziehen als in Deutschland üblich. Dies sei aber nicht automatisch ein Plädoyer für die Gesamtschule, denn "die Lehrerschaft ist hier noch nicht bereit für das Gesamtschulsystem."
- McKinsey mahnt eine wesentlich stärkere Förderung der frühkindlichen Bildung und des Grundschulbereiches an: "Lieber früher investieren, als später reparieren." Die Anzahl der Krippen- und Ganztagesplätze müsse ausgebaut und die Qualität der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen verbessert werden.
- In Zeiten knapper Kassen müsse zudem darüber nachgedacht werden, die Primarstufe (Grundschule) durch Umschichtungen von Mitteln aus der wesentlich besser ausgestatteten Sekundarstufe zu fördern.
Timss/III-Studie
Timss/III-StudieSchon bei der 1999 veröffentlichten so genannten Timss/III-Studie (Third International Mathematics and Science Study), die mathematisches und naturwissenschaftliches Können von Schülern in 24 Ländern analysierte, landete Deutschland nur im hinteren Mittelfeld.
Timss zeigte, dass die deutschen Schüler ihrer globalen Konkurrenz oftmals um Jahre hinterherhinken. Die Sieger-Schüler aus Singapur, Japan oder Südkorea beherrschten bereits in der achten Klasse so viel Mathematik wie die deutschen erst zwei oder drei Jahre später. „Solche Vorsprünge sind praktisch nicht mehr einholbar“, schrieben die deutschen Timss-Koordinatoren in ihren Abschlussbericht
Erste Ergebnisse der Schulleistungsstudie PISA 2000
PISA Deutschland
PISA OECD
Die Zeit: Schulbildung
GEW: Pisa-Seiten
Rede von Bundespräsident Johannes Rau beim Abschlusskongress des Forum Bildung (10.01.02):
"Bildung ist wichtig. Bildung ist ein Thema, das zu lange vernachlässigt worden ist."
Literatur
Zeitschrift Der Bürger im Staat
Bildungspolitik
Heft 4/97
Hrsg.: LpB
Bildungssysteme sind dazu da, die Zukunft einer Gesellschaft zu sichern, wie jegliche Form von Sozialisation überhaupt. Ein jedes Bildungssystem muss sich immer wieder daraufhin befragen lassen, inwieweit es dazu in der Lage ist: nach Organisation, nach den dafür zur Verfügung gestellten Ressourcen, vor allem aber nach den Lernzielen und Inhalten.
Voraussetzung einer Anpassung des Bildungssystems an die Erfordernisse der Zukunft ist eine genaue und nüchterne Analyse der Gegenwart und die Herausarbeitung der wichtigsten Tendenzen, die sich in ihr für die Zukunft bereits zeigen. Ohne Abschätzung zukünftiger Erfordernisse ist eine Reform des Bildungssystems nicht zu machen. So schwierig die Zukunft vorauszusagen ist, einige zentrale Tendenzen sind durchaus erkennbar.
Schulstudie PISA-E
Zusätzlich zur internationalen PISA-Studie (Programme for International Student Assessment) hatten die deutschen Kultusminister im Rahmen einer nationalen Ergänzungsstudie (PISA-E) weitere 50.000 Schüler aus 1.246 Schulen in die Untersuchung einbezogen. PISA-E soll Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit der Schulsysteme in den einzelnen Bundesländern erlauben. Scherpunkte der Untersuchung waren vor allem Lese- und Textverständnis, aber auch Mathematik und Naturwissenschaften.
Eines dürften der PISA-Test des vergangenen Jahres und der nationale PISA-E-Test gemeinsam haben: Der Schockeffekt ist beim zweiten Mal so groß wie beim ersten.
Die Ergebnisse des nationalen Leistungstests sind deprimierend: es gibt ein starkes Nord-Süd-Leistungsgefälle. Demnach landet Bayern auf Platz eins, Baden-Württemberg auf Platz zwei des bundesdeutschen Schul-Rankings. Auf dem dritten und vierten Platz sind in etwa punktgleich Sachsen und Rheinland-Pfalz vertreten. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen landet bei dem Leistungstest im Mittelfeld. "Schlusslichter" bilden das Saarland, Sachsen-Anhalt und Bremen. Hamburg und Berlin wurden bei der PISA-Studie nicht berücksichtigt, da sie die notwendige Datenbasis glatt verfehlt hatten. 80 Prozent der Schüler an den untersuchten Schulen müssen am Test teilgenommen haben, um eine solide Auswertung zu ermöglichen. In Hamburg lag die Teilnahmequote allerdings lediglich bei 70 Prozent, in Berlin nur bei der Hälfte.
Zwischen den deutschen Schulen klafft nicht nur ein großes Leistungsgefälle. Auch die Lehrer machen krasse Unterschiede bei der Notenvergabe. So kann ein Gymnasiast für dieselbe Leistung in Mathematik in einem Fall eine Eins oder eine Zwei, im anderen Fall eine vier oder gar eine Fünf erhalten.
Lesekompetenz der 15-Jährigen:
| Naturwissenschaftliche Leistung der Neuntklässler an Gymnasien:
|
Naturwissenschaftliche Grundbildung der 15-Jährigen:
| Naturwissenschaftliche Leistung von Neuntklässlern allgemein:
|
| Mathematische Grundbildung der Neuntklässler in Gymnasien:
|
Das PISA-Desaster gibt Kritikern am System der Länder-Schulhoheit neuen Auftrieb. Mit Bayern schafft nur ein Bundesland den Aufstieg in das obere internationale PISA-Leistungsdrittel, vergleichbar mit Schweden und Österreich (Rang 9 und 10), wo die "Verlierer" international einzuordnen sind (Deutschland insgesamt Rang 25), darf man gar nicht fragen.
Abbildung: Mittlere Leseleistung für 14 Bundesländer
Als wichtigstes Ergebnis der Tests sieht die GEW den aufgezeigten Zusammenhang zwischen Schulleistung und sozialer Herkunft, der hier zu Lande am stärksten sei. In keinem anderen Land entscheidet die soziale Herkunft so deutlich über den Zugang zu Bildung wie in Deutschland. Die Leistungsunterschiede zwischen Jugendlichen, die aus Migrationsfamilien stammen, und Jugendlichen, deren beide Eltern in Deutschland geboren wurden, sind in allen untersuchten Kompetenzbereichen erheblich.
Die durchschnittliche Stundentafel der Bundesrepublik sieht bei der Annahme von 36 Unterrichtswochen pro Jahr für die Jahrgangsstufen 1 bis 9 insgesamt rund 8.600 Unterrichtsstunden à 45 Minuten vor. Das mittlere Jahresaufkommen beträgt etwa 955 Stunden. Mit dieser Information lässt sich eine Vorstellung von der Bedeutung der Länderunterschiede gewinnen. Nimmt man die Extremwerte des nominellen Unterrichtsaufkommens von der 1. bis zur 9. Jahrgangsstufe – also Berlin mit rund 8.100 und Bayern mit 9.300 Unterrichtsstunden –, so beläuft sich die über die Jahrgangsstufen hinweg kumulierte Differenz auf mehr als ein Schuljahr.
Der Leiter der PISA-International-Studie, Andreas Schleicher, warnte die deutschen Länder vor Fehleinschätzungen auf Grund der nationalem Ergebnisse. Die Bundesrepublik müsse sich bei ihrer dringend notwendigen Schulreform die besten Bildungssysteme der Welt zum Vorbild nehmen. Weder Unions- noch SPD-geführte Bundesländer könnten derzeit im internationalem Bildungsvergleich mithalten - auch Bayern liege «nur knapp über dem OECD-Mittel» der wichtigsten Industrienationen.
PISA-E - Zusammenfassung (PDF)
Pisa E - Vertiefender Länderbericht
Ein differenzierter Blick auf die Länder der Bundesrepublik Deutschland (PDF)
Kultusministerkonferenz
DBS: PISA-E - Vergleich der Bundesländer
ZUM: Der nächste PISA-Schock: "PISA-E ist da !"
Netzeitung.de: Nur Bayern ist bei Bildung besser als OECD-Durchschnitt
Kultusministerkonferenz beschließt einheitliche Bildungsstandards
Zwei Jahre nach dem Pisa-Schock haben die Kultusminister der Länder einheitliche Bildungsstandards zumindest in den Fächern Deutsch, Mathematik und in der ersten Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss sowie eine Vereinbarung über Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10) festgelegt.
Die Länder haben sich bei der 304. Kultusministerkonferenz am 04.12.2003 verpflichtet, die jetzt verabschiedeten Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss zu Beginn des Schuljahres 2004/2005 als Grundlage der fachspezifischen Anforderungen zu übernehmen. Dies betrifft insbesondere die Lehrplanarbeit, die Schulentwicklung sowie die Lehreraus- und –fortbildung. Die Einhaltung der Standards soll ab 2006 länderübergreifend überprüft werden. Die Kultusministerkonferenz hat sich darauf verständigt, hierzu eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung zu gründen, das „Wissenschaftliches Institut der Länder zur Qualitätssicherung“.
KMK: Kultusministerkonferenz beschließt Bildungsstandards im Fach Deutsch, im Fach Mathematik und in der ersten Fremdsprache (Englisch/Französisch) für den Mittleren Schulabschluss sowie eine Vereinbarung über Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (Jahrgangsstufe 10)
Die neue KMK-Vereinbarung schreibt z.B. für das Fach Deutsch vor, dass Schüler am Ende der 10. Jahrgangsstufe "sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen, sich durch Fragen notwendige Informationen beschaffen sowie eine eigene Meinung begründet und nachvollziehbar in freier Rede vertreten können". Beim Lesen sollen sie einen Roman von einer Novelle unterscheiden können. Verlangt wird, Texte wie etwa einen Lebenslauf „in gut lesbarer handschriftlicher Form“ abzufassen und entsprechend Zweck und Adressat sinnvoll zu strukturieren. Zum neuen Schulstandard gehört auch das Nutzen von Textverarbeitungsprogrammen.
In Mathematik gehören neben dem sicheren Beherrschen der grundständigen Rechengesetze auch Überschlagrechnen, Algorithmen und das Beherrschen geometrischer Konstruktionen zum Standard-Programm.
In der ersten Fremdsprache - überwiegend Englisch - sollen sich die Schüler nach der 10. Klasse sowohl in „alltags- wie berufsbezogenen Themen“ verständigen können. Schriftlich wie mündlich sollen sie Informationen und Gedanken darlegen und zu anderen Positionen Stellung beziehen können.