Politik und Popkultur

Dem Spannungsverhältnis von Politik und Popkultur widmet sich dieses Dossier. Politik wird nämlich auch in der Popkultur verhandelt – in fiktiven Angeboten der Unterhaltungsindustrie wie Filmen, Fernsehserien, Musik oder Computerspielen.
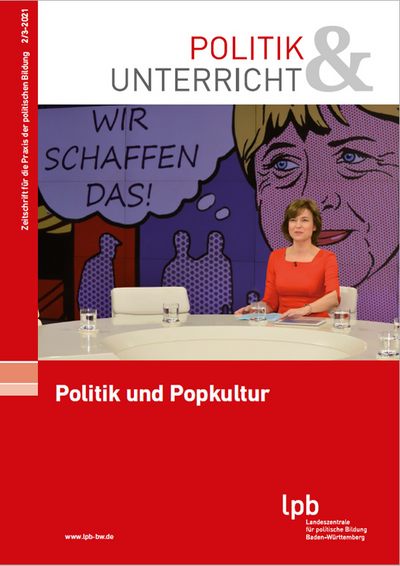
Autor: Prof. Dr. Markus Gloe
Prof. Dr. Markus Gloe ist Professor für Politische Bildung und Didaktik der Sozialkunde an der Ludwig-MaximilianUniversität München.
Der Text ist als Einführung in der Zeitschrift „Politik und Popkultur“ (Politik & Unterricht 2021) erschienen.
Das Heft enthält eine Fülle von Materialien für den Unterricht in der Sekundarstufe I. Es greift in fünf Bausteinen verschiedene Aspekte der Popkultur anhand aktueller Erscheinungsformen auf und bietet somit Materialien für einen künstlerischen Zugang zu politischen Themen.
Einführung: Politik und Popkultur
Die Zeiten, in denen in den Familien gemeinsam um 20 Uhr die Tagesschau im Fernsehen angesehen wurde und im Anschluss die aktuellen politischen Fragen diskutiert wurden, sind längst vorbei – falls es sie denn überhaupt je so gegeben hat. Individueller und fragmentierter Medienkonsum ist heute die Realität. Aber Politik wird dennoch verhandelt, wenn auch nicht (mehr ausschließlich) im Kreise der Familie und im Zusammenhang von Nachrichtensendungen, sondern auch in fiktiven Angeboten der Unterhaltungsindustrie wie Filmen, Fernsehserien, Musik oder Computerspielen. Aber auch Literatur und Kunst sind Bereiche, die sich der Popkultur zuordnen lassen und in denen Verbindungen zur Politik nicht erst in neuester Zeit nachgezeichnet werden können.
Bereits 1984 bezeichnet James Combs das Zusammenspiel von Politik und Popkultur als Polpop. Gleich zu Beginn seiner Untersuchung hält er fest: „Popular culture both shapes and reflects our ideas, therefore affecting our perceptions and actions about politics“ (Combs 1984, 3).
In „Deutsches Theater“ aus dem Jahr 2002 hatte der „Pop-Literat“ Benjamin von Stuckrad-Barre den Schulterschluss zwischen Pop und Politik zum zentralen Gegenstand gemacht. Politische Akteure würden dabei den „imagefördernden Impetus von Pop“ (Kurp/ Hauschuld/Wiese 2002, 77) für sich entdecken.
Die Formen und Formate sind vielfältig:
- Politiker/-innen und Künstler/-innen treten gemeinsam auf,
- Politiker/-innen übernehmen Gastrollen in Fernsehserien und Filmen,
- Interviews und Fotostrecken von Politiker/-innen erscheinen in Lifestylemagazinen usw.
Manches davon kann sich negativ auf das Ansehen der politischen Akteure und Institutionen auswirken, weil es Politik auf das Private, auf Stimmungen reduziert (vgl. Nieland 2009, 18).
Politik und Musik
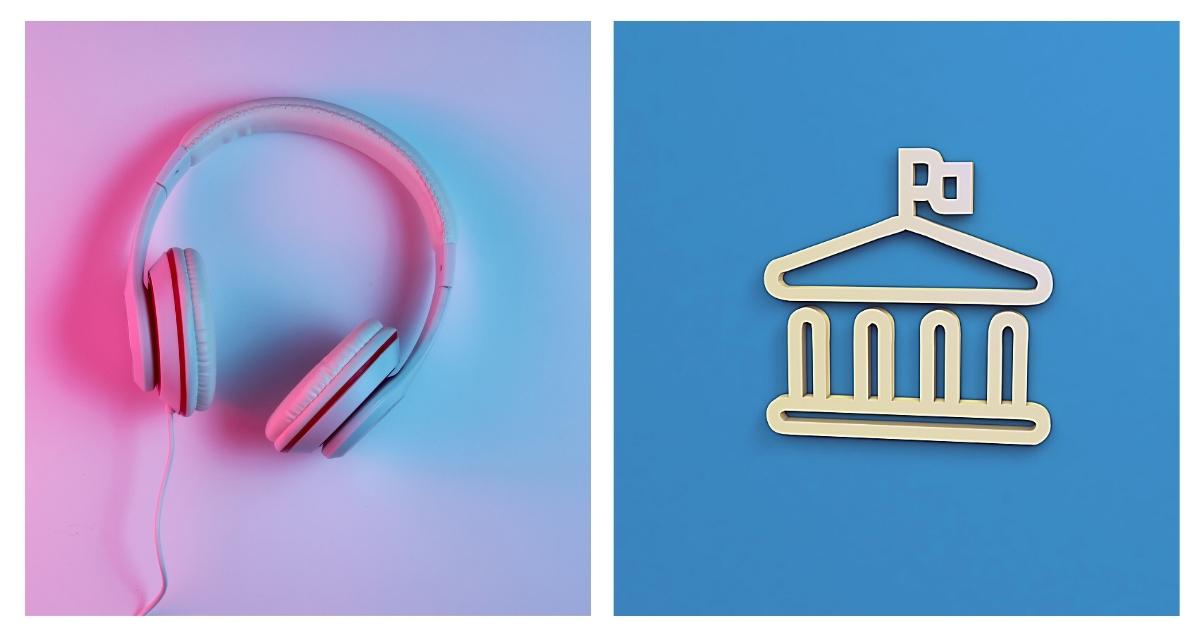
Aber Popkultur selbst übernimmt auch eine gesellschaftspolitische Funktion. So können popkulturelle Produkte selbst ein Statement zu politischen Fragen sein. Beispielsweise kann Musik in die politische Sphäre eingebettet sein. Ute Canaris spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Musik als „Magd, Begleiterin wie Modell der Politik“ (Canaris 2005, 25) angesehen werden kann. Der Begriff der „Magd“ bezieht sich auf die absichtsvolle Indienstnahme von Musik für politische Zwecke.
Musik als Begleiterin von Politik bezieht sich darauf, dass bestimmte Lieder in besonderer Weise einen „Zeitgeist“ widerspiegeln. Sie fungieren gewissermaßen als „Soundtrack“ für eine bestimmte historische Phase.
Musik als Modell von Politik verweist auf deren utopischen Gehalt. In zahlreichen Liedern beschwören Bands sowie Künstlerinnen und Künstler eine Welt, die so viel besser sein könnte, als die gegenwärtige es ist. Unabhängig von der Intention auf der Produzentenseite entscheidet auch der Kontext, in dem das Lied gespielt wird, ob es sich um ein politisches Lied handelt oder nicht.
Die Verbindung von Musik und Politik zeigt sich aber auch:
- in der Musikperformance, z. B. in der Bühnenshow, bei Live-Auftritten, dem historisch-politisch aufgeladenen Ort der Aufführung von Konzerten, in der Visualisierung von Musik,
- in politischen Äußerungen und Gesten der Musikerinnen und Musiker,
- in den Gruppennamen von Ensembles und Bands, bei den Titeln und der Gestaltung von Plattencovern, Homepages u. a.
Politik und Serien
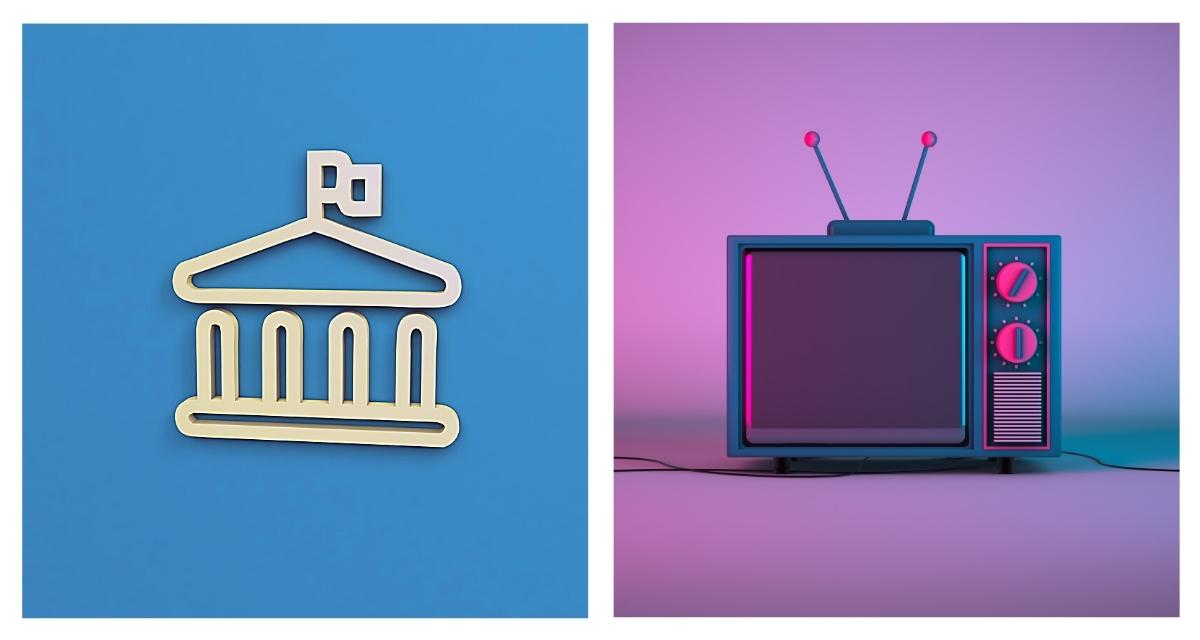
Ein weiteres Beispiel für die Verbindung von Politik und Popkultur sind Politik-Serien. Sie erleben im internationalen Fernsehen und in Streaming-Diensten eine „ausgeprägte Konjunktur“ (Dörner/Simond 2018, 33) und können ebenfalls als Phänomene des Politainments (Dörner 2001) angesehen werden.
Serien wie „The West Wing – Im Zentrum der Macht“ oder „House of Cards“ feiern Erfolge und erhalten Auszeichnungen. So konnte beispielsweise „The West Wing“ vier Mal in Folge in den Jahren 2000 bis 2003 den Emmy-Award in der Kategorie „Outstanding Drama Series“ gewinnen. Im Jahr 2001 erhielt die Serie den Golden Globe Award in der Kategorie „Best Television Series – Drama“. Auch „House of Cards“ konnte den Emmy Award sowie den Golden Globe Award für die beste Hauptdarstellerin und den besten Hauptdarsteller gewinnen. In zahlreichen Studien wurden Auswirkungen vom Konsum von Serien auf politische Haltungen und Einstellungen nachgewiesen (z. B. van Zoonen 2005). Dörner und Simond schließen daraus, „dass Produzenten wie Rezipienten die seriell-fiktionale Konstruktion politischer Welten und Akteure für besonders relevant und/oder erfolgversprechend halten“ (Dörner/Simond 2018, 33).
In den letzten Jahren sind einige Polit-Serien produziert worden, die speziell das politische Geschehen in Szene setzen: z. B. „House of Cards“, „Borgen“, „Scandal“, „Madame Secretary“, „Designated Survivor“, „Marseille“, „Stadt der Macht“ usw. Auffällig ist dabei, dass einige Serien durch die Darstellung der Politikerinnen und Politiker als ehrliche Makler, eine dargestellte Transparenz oder den offenen Diskurs als Mittel der Politik ein ausgesprochen positives Politikbild zeichnen (z. B. „The West Wing“, „Designated Survivor“, „Madame Secretary“).
Ein weiteres Konzept ist die Darstellung von Realpolitik, in der „gute Ziele“ mit fragwürdigen Mitteln erreicht werden (z. B. „Borgen“, „Die Stadt der Macht“) (vgl. Carstensen 2016, 948).
In eine dritte Kategorie fallen Serien, die durch die Betonung von Machterlangung bzw. Machterhalt als Ziel von Einzelnen, Manipulation eines ineffizienten politischen Systems und Skandalen ein stark negatives Bild von Politik vermitteln (z. B. „House of Cards“, „Scandal“). Anders als in den Politthrillern der 1960er-Jahre (wie beispielsweise „Botschafter der Angst“) oder der 1970er-Jahre (wie in den Filmen „Die drei Tage des Condor“ oder „Die Unbestechlichen“) (vgl. Kohlmann 2017) stehen dabei nicht mehr nur Männer im Rampenlicht (z. B. „Commander in Chief“, „The Amazing Mrs. Pritchard“, „Scandal“, „The Good Wife“ usw.)
Polit-Serien lassen sich auch nach der politischen Ebene einteilen, auf der sie spielen. Es gibt zum einen die Serien, die ein internationales Setting aufweisen (z. B. „Madame Secretary“, „Occupied – Die Besatzung“), den nationalen Kontext eines einzelnen Landes mit Anleihen zum Internationalen in den Blick nehmen (z. B. „House of Cards“ [USA], „Borgen“ [Dänemark], „Der Mechanismus“ [Brasilien], „Kanzleramt“ [Deutschland]), und nicht zuletzt auch Serien, die die Lokalpolitik fokussieren (z. B. „The Wire“ [Baltimore], „Show Me A Hero“ [Yonkers im Norden von New York City], „Hindafing“ [fiktiver bayerischer Ort], „Marseille“).
Es gibt aber auch Serien, die sich einer speziellen politischen Thematik widmen:
- So gibt es zahlreiche Serien, die nach den Ereignissen des 11. Septembers 2001 eine dauerhafte Terrorbedrohung und Terrorbekämpfung in den Mittelpunkt rücken (stellvertretend für viele Kleiner 2017): z. B. „24“, „Sleeper Cell“, „The Unit“, „Strike Back“, „Person of Interest“, „American Odyssey“ oder „Homeland“.
- Weitere Serien widmen sich der Frage von menschlicher Genmanipulation (z. B. „Biohackers“), den Fragen von Überwachung und Datenklau (z. B. „You are wanted“) oder dem Einsatz von Spionen in fremden Staaten (z. B. „Berlin Station“, „West of Liberty“).
- Andere Serien nehmen wiederum das Zusammenwirken von Medien und Politik in den Blick. Vor allem die Bedeutung von Nachrichten im Politikbetrieb wird z. B. in „Newsroom“ oder „The Loudest Voice“ thematisiert. Wiederum andere Serien setzen sich mit Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und der Gerechtigkeit auseinander wie z. B. „Suits“, „Better Call Saul“, „Making a Murderer“ oder „Breaking Bad“ (vgl. Müller-Mall 2018).
Darüber hinaus könnten die Serien auch über die Gattung kategorisiert werden. Die meisten Polit-Serien sind wohl der Gattung Thriller zuzuordnen. Aber es gibt auch Satiren und Komödien (z. B. „Veep, „Alpha-House“, „The Thick Of IT“, „The Politician“, „Eichwald MdB“) und Zeichentrickserien (z. B. „The Simpsons“, „Southpark“).
Des Weiteren gibt es zahlreiche andere Serien-Genres, die ebenfalls das Politische berühren oder verarbeiten, aber nach der Definition von Dörner und Simond nicht klassisch zu den Polit-Serien gezählt werden. Zu nennen sind hier Zombie-Serien wie z. B. „The Walking Dead“ (vgl. Besand 2018b), Science-Fiction-Serien wie z. B. „The Game of Thrones“ (vgl. Koch 2018) oder „Star Trek“ (vgl. Kanzler 2018), Superhelden-Serien wie z. B. „Daredevil“ oder „Luke Cage“ aus der Marvel-Reihe oder „Arrow“ aus der DC-Welt (vgl. Schwarke 2018) sowie Western-Serien wie z. B. „Bonanza“ (Georgi-Findlay 2018).
Politik und Computerspiele

Themen, Settings, Mythen oder Symbole aus der Sphäre der Politik finden auch Verwendung in der Konstruktion und dem Aufbau fiktionaler Welten in Computer- oder Videospielen. Im Vergleich zu anderen Medien bieten sie der Spielerin bzw. dem Spieler die Möglichkeit, im Bewusstsein des Andersseins zu handeln.
Der Spieler oder die Spielerin steuert und handelt dementsprechend in der virtuellen Welt mit einer Spielfigur; die Spielwelt wird dem Spieler als „beherrschbare Lebenswelt“ (Warwitz/Rudolf 2004, 102) präsentiert. Dies ist zwar eine Grundkomponente von Spielen allgemein, jedoch bedarf es in Videospielen keiner Imagination der Spielwelt. Es bedarf eines „Nutzereingriffs“ (Ladas 2002, 38), ohne den das Videospiel nicht auskommt. Man bewegt sich und handelt in einer virtuellen Welt, die als Spielfeld fungiert. Durch „handlungssensible Bildelemente“ (Fritz 2005, 24) kann der Spieler in der virtuellen Welt agieren. Es lassen sich Zukunftsszenarien und Konfliktlinien in Computer- und Videospielen durchspielen.
Aber auch Computer- und Videospiele wie z. B. Ego-Shooter, die im ersten Moment kaum Anknüpfungspunkte für politische Bildung zu bieten scheinen, können sich durch eine gezielte Reflexion beispielsweise zur Förderung einer Wertereflexionskompetenz nutzen lassen.
Die Potenziale von Videospielen für Bildungskontexte rückten vor allem im Rahmen von Game-Based-Ansätzen in den Fokus. Wegen ihrer Verbindung von Lerninhalten und Gamification können Serious Games als Zwischenglied zwischen reinen Lernspielen und klassischen unterhaltenden digitalen Spielen gelten. In diesem Zusammenhang wird auch vom sogenannten Edutainment gesprochen.
Serious Games wollen die Spielenden nicht vordergründig unterhalten. Sie können dabei unterstützen, bestimmte Problemlösekompetenzen aufzubauen. Sie bieten damit den Lernenden die Möglichkeit, spezifische Lerninhalte spielerisch zu ergründen (Abt 1971). Serious Games haben damit eine „Doppelmission“: „Ernsthafte Ziele müssen erreicht werden, ohne das Spielerlebnis zu korrumpieren“ (Wiemeyer 2016, 17).
Der Anwendungsbereich von Serious Games ist vielfältig. Sie finden sich in der Medizin, in der Erwachsenenbildung sowie beim Militär oder in weiteren Bildungskonzepten wieder.
- Als Beispiel mit politischem Inhalt sei „Orwell: Keeping an Eye on You“ genannt. In diesem Spiel geht es darum, dass man ganz nach der Manier des Romans 1984 von George Orwell Teil eines Überwachungsstaates ist und man entscheiden muss, welche mitunter folgenschweren Informationen man weitergibt.
- Spiele wie „Path Out“ oder „Papers, Please“ konfrontieren die Spielerinnen und Spieler mit dem Thema Asyl.
- Aber auch historische Settings werden angesprochen, z. B. „Through the darkest of Times“. Das Spiel startet 1933 mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. In diesem Strategiespiel übernimmt man die Rolle von Widerständigen im „Dritten Reich“. Hierbei müssen unbequeme Entscheidungen getroffen werden, um das eigene Leben zu retten. Auch tragen die Auswirkungen von Handlungen weitreichende Folgen mit sich.
- „Demokratie 3“ wiederum ist ein Spiel, das versucht, die komplexen Zusammenhänge einer demokratischen Regierung abzubilden und spielerisch erlebbar zu machen.
Der pädagogische Zweck muss jedoch nicht zwingend schon bei der Produktion der Spiele intendiert sein. Er kann auch erst im Anschluss beim Einsatz in der Bildungssituation an das digitale Spiel herangetragen werden (Breuer 2017, 2). Jenkins u. a. schlagen deshalb vor, besser von Serious Gaming zu sprechen, um so den Fokus auf die Spielenden zu richten (Jenkins u. a. 2009). Die entscheidende Frage ist damit: „Wie kann man digitale Spiele sinnvoll/gewinnbringend/effektiv zu ernsten/pädagogischen Zwecken einsetzen?“ (Breuer 2017, 2)
Politik und Comics

Andreas Platthaus definiert Comics als „Kunst der Bildung, Erfindung und Herstellung einer Verbindung von Text und Bild. Und es ist ohne Belang, welchen Charakter der Text hat“ (Platthaus 2001, zit. nach Bolz 2003, 219).
Heute sind Comics nicht nur bei Jugendlichen allgegenwärtig. Die Protagonisten in den Comics reichen von Figuren, die mittlerweile zu Ikonen geworden sind (z. B. Mickey Mouse, Asterix und Obelix oder Lucky Luke), bis hin zu unbekannten Comicfiguren. Auch wenn die Erwartungen häufig noch in Richtung Spaß und Unterhaltung gehen, werden in dem Medium selbst schon lange politische Gegenstände verhandelt (vgl. Fix 2012).
Die Erfindung der Marvel-Comicfigur „Black Panther“ ist eng mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA verbunden. Als 2018 der erste Film mit dieser Figur ins Kino kam, war dies nicht nur ein filmisches Ereignis. Generell können die in den letzten Jahren sehr populär gewordenen Superhelden als Projektionsfläche politischer und gesellschaftlicher Fragen dienen. So geht es oft um einen Kampf Gut gegen Böse oder für die Freiheit.
Die Comic-Künstlerin Paulina Stulin sagt in einem Interview auch entsprechend: „Mein Bestreben ist es, die Politik künstlerischer zu machen und die Kunst politischer.“
Bolz hält fest, dass Comics eine politische Bedeutung nicht allein deshalb zukommt, „weil sie vielleicht heimlich unter der Bettdecke gelesen werden, sondern weil die Charaktere der einzelnen Figuren natürlich Absichten unterliegen“ (Bolz 2003, 227). Aber Comics dienen nicht nur als Ausdrucksmittel von politischen Bewegungen, sondern es finden sich auch vielfache Beispiele für den Einsatz von Comics als Propagandamittel.
Autor: Prof. Dr. Markus Gloe, Stand der Aktualisierung: September 2023, aufbereitet durch die Internetredaktion LpB BW.

