Demokratiebildung in einzelnen Fächern
Fächersteckbriefe und passende Angebote der Landeszentrale für politische Bildung

Wie gelingt Demokratiebildung im Unterricht und in der Schule? Diese Seite gibt einen Überblick für Lehrkräfte, welche Materialien und Angebote sich für einzelne Unterrichtsfächer eignen. Außerdem liefern die Fächersteckbriefe Schnittmengen zur Demokratiebildung sowie Anregungen und Impulse, wie Demokratiebildung auch in Fächern wie Geografie, Deutsch oder im Sprachunterricht implementiert werden kann.
Deutsch und Demokratiebildung

Schnittmengen
- Diskussionsfähigkeit (Meinungen begründen und Stellungnahmen formulieren, Zuhören, Respekt im Gespräch, Debattieren, Diskussionen leiten usw.); gelingende und misslingende Kommunikation
- schriftliches Erörtern (Argumente finden, ausführen, analysieren und bewerten; differenzierte und abwägende Texte verfassen; meinungsbildende Textsorten)
- Recherche von Informationen und deren kritische Auswertung, Wiedergabe und Aufbereitung (auch medial)
- differenzierte Auseinandersetzung mit fremden Lebenswelten und Lebensentwürfen (Alterität)
- Umgang mit Medien (Wissen, kritische Nutzung, Gestaltung, Reflexion eigenen Medienverhaltens und des Mediensystems): Printmedien, Rundfunk, Fernsehen sowie Internetangebote
- Auseinandersetzung mit Formen der Überzeugung und Manipulation
- Sachtexte zu einschlägigen Themen lesen und analysieren (z. B. Öffentlichkeit, Presse, Sprache der Medien)
- thematisch einschlägige literarische Texte erschließen
- Sprache(n) der Öffentlichkeit (z. B. in sozialen Medien, Dialekt und Jugendsprache)
- Sprache und Kommunikation auf Werte, Funktionen und (politische) Interessen untersuchen
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Erarbeitung einer grundschulgerechten Annäherung an Demokratie und Grundrechte (z. B. anhand von „Ich bin für mich“ von Martin Baltscheit, „Irgendwie Anders“ von Kathryn Cave oder „Der überaus starke Willibald“ von Willi Fährmann)
- Umsetzung des Grundschulplanspiels „Eine Straße für Felddorf“: www.kinderdemokratie.de/planspiel
- Erstellung einer Seite für eine Schülerzeitung/Zeitung (Berichte, Kommentare, Glossen, Karikaturen usw.) zu Ereignissen oder zu Entwicklungen in der Zukunft
- Herausarbeiten und Diskutieren von unterschiedlichen Geschlechterrollen und Aspekten der Geschlechtergerechtigkeit in unterschiedlichen literarischen oder filmischen Genres
- theatralische Erfahrungen mit demokratierelevanten Themen (z. B. Perspektivwechsel, Rollenwechsel, Rollenbiographien usw.) in AGs, Projekten oder im Fach Literatur und Theater
- kritische Analyse von Strategien und Ästhetik der Werbung
- Analyse pragmatischer Texte (z. B. Reden, Presse) hinsichtlich Formen der Persuasion und Manipulation
- Erörterungen und „Debating“ zu aktuellen und altersgerechten Themen sowie zur Meinungsfreiheit und ihrer Grenzen
- Auseinandersetzung mit Realität und Fiktion, z. B. Lügengeschichten erzählen und erkennen, Film-Fake erkennen: „Spiel mit dem Tod“; Fakes auf YouTube; Faktencheck zu Fake News durchführen (z. B. „Fakefinder” des SWR)
Angebote der Landeszentrale für politische Bildung
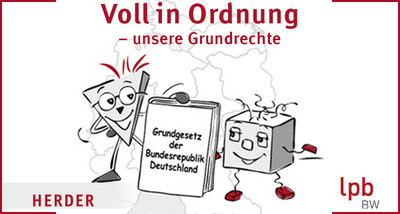
Grundrechte im Netz: Voll in Ordnung
Die Grundrechtefibel für Kinder ab 8 Jahren
Mit Geschichten rund um Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit vermittelt die Webseite zur Grundrechtefibel anschaulich Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes und deren Bedeutung. Ein Glossar erklärt wichtige Begriffe altersgerecht für Grundschulkinder und Interessierte.

Verschwörungstheorien
Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Welche Rolle spielt das Internet in der Verbreitung von Verschwörungstheorien? Worin bestehen konkret die Gefahren in Verschwörungstheorien? Und wie können Verschwörungstheorien entkräftet werden?
mehr
Geografie und Demokratiebildung
Fachsteckbrief und Angebote

Schnittmengen zur Demokratiebildung
- systemische Analyse und Bewertung natur- und gesellschaftswissenschaftlicher Prozesse
- Problemlösungs- und handlungsorientierte Untersuchung von Räumen im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips bzw. einer nachhaltigen Entwicklung (relevante Aspekte: Grund- und Menschenrechte, globale Gerechtigkeit, ökonomische Interessen und ihre Auswirkungen auf den Menschen und seine Lebensbedingungen)
- Beurteilung zukunftsfähiger Lösungsansätze in Hinblick auf politische, ethische und soziale Implikationen
- Handlungskompetenz im System Mensch-Erde auf der Grundlage geographischer Kompetenzen (z. B. in Bezug auf verantwortungsvolle Konsumentscheidungen, eigenes Engagement für Nachhaltigkeit, Menschenrechte und globale Gerechtigkeit)
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- World Climate – ein simulationsorientiertes Rollenspiel für den Klimaschutz
- Weltspiel – ein Aktionsspiel zur gerechten Verteilung von Ressourcen (z. B. www.epiz.de)
- klimaneutrale Lebens- und Arbeitsweisen auf der lokalen Ebene beschreiben und Handlungsansätze entwickeln (z. B. über Planspiele und Szenarien)
- Stadtentwicklung: Lokale Agenda 21, Zukunftswerkstatt Stadt-, Raum- und Regionalplanung: Sinn, Ziel, Prozess
- Entscheidung auf unterschiedlichen Maßstabsebenen (lokal, regional, national)
- Entwicklungszusammenarbeit: eigene Handlungsmöglichkeiten überprüfen, z. B. über lokale Projekte der Entwicklungszusammenarbeit
- Generationenvertrag, etwa zur Wasserversorgung, Wasserqualität oder zum Thema Klimawandel – auch im lokalen Bezug
- globale Lösungsansätze und Entscheidungsfindungsprozesse zur Bekämpfung globaler Herausforderungen, z. B. globale Meeres-Governance, internationale Klimaschutzabkommen (COP-Prozess), Menschenrecht auf Wasser, Biodiversitätskonvention u.a.m.
- interkulturelles Lernen: Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern und Fachkräften aus der Entwicklungszusammenarbeit über das Programm „Bildung trifft Entwicklung“
Angebote der Landeszentrale für politische Bildung
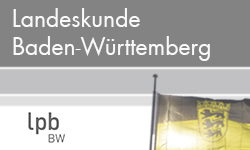
Landeskunde Online
Landeskunde Baden-Württemberg
Welche historischen Territorien gab es im Südwesten? Wie ist Baden-Württemberg geographisch aufgebaut? Das LpB-Landeskunde-Portal beantwortet nicht nur geographische, sondern auch politische, historische und kulturelle Fragen.

Baden-Württemberg – Eine Landeskunde (zwei Bände)

Don@u-Online-Projekt
Begegnung von Schulklassen des Donauraums
Beim deutschsprachigen Projekt Don@u-Online begegnen sich Schulklassen aus den Donauanrainerstaaten. Dabei beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur im eigenen Unterricht mit dem aktuellen Projektthema, sondern teilen ihre Ideen virtuell mit den anderen Schulklassen und setzen diese um.
Weitere Links zu den Angeboten der LpB BW
LpB nach Themen
Unter diesen Links finden Sie Hintergrundberichte, Veranstaltungen und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung zu folgenden Themen
Geschichte und Demokratiebildung

Schnittmengen
- historische Bedingtheit der heutigen Demokratien, auch an Beispielen der lokalen Geschichte
- verschiedene Modelle der Partizipation an Macht von der Antike bis heute
- Entwicklung möglicher Handlungsoptionen aus der Geschichte für aktuelle Probleme und für die Zukunft
- Liberalisierungstendenzen und Emanzipationsbewegungen in der Geschichte
- Analyse des Modells der liberalen Demokratie (Menschen- und Bürgerrechte, Partizipation, Pluralismus, Verfassung, Gewaltenteilung, Parlamentarisierung, Individualismus, Marktwirtschaft)
- Überprüfung eigener und fremder Wertorientierungen (z. B. Grundrechte)
- Analyse demokratischer Verfassungen (Gewaltenteilung)
- Durchbruch und Scheitern demokratischer Verfassungen in der Geschichte
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Überprüfung der Möglichkeiten politischer Teilhabe und ihres Zustandekommens in den verschiedenen Epochen der Geschichte, (z. B. griechische Poliswelt, Römische Republik, Mittelalterliche Stadt / Stadtrat, Frankreich nach der Revolution / Zensuswahlrecht, Frankfurter Paulskirchenparlament, Weimarer Verfassung / Frauenwahlrecht, Grundgesetz / Verfassung der DDR), dabei regionalgeschichtliche und biografische Ansätze berücksichtigen
- Filmanalyse „Herr der Fliegen“ anhand der Leitfrage: Wer soll herrschen und mit welcher Legitimation?
- Auseinandersetzung mit Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus in der Geschichte
- Auseinandersetzung mit Liberalisierungstendenzen und Emanzipationsbewegungen der Geschichte, insbesondere der Zeitgeschichte nach 1945 (z. B. Frauenrechte, Rechte Homosexueller, Bürgerbewegungen in West und Ost)
- Auseinandersetzung mit dem Europäischen Einigungsprozess, mit der Europäischen Integration
- Diskussion um den Umgang mit Recht und Zensur in den beiden deutschen Teilstaaten nach 1945 (war die DDR ein Unrechtsstaat?)
- Diskussion um die Sinnhaftigkeit von Parteienverboten
- Zustandekommen und Erfolg der „Friedlichen Revolution“ in der DDR (z. B. Montagsdemonstrationen, „Runde Tische“)
- Fachportal Landeskunde und Landesgeschichte Baden-Württemberg
Angebote der LpB

Portal: DDR im Unterricht
Hintergrundinformationen und Unterrichtsmaterialien
Was sollten Schülerinnen und Schüler über die DDR wissen? Wo findet man Unterrichtsmaterial oder Kontakte zu Zeitzeugen? Welche Fortbildungen können Lehrkräfte zur DDR besuchen? Das LpB-Portal „DDR im Unterricht” weist auf geeignete Publikationen und Ansprechpartner hin.
Künstlerisch-musische Fächer und Demokratiebildung

Schnittmengen
Schnittmengen
- konstruktive Interaktionsprozesse, Einbringen in Gruppenprozesse, Anerkennung der eigenen Leistung und jener von anderen
- selbstständiges Planen, Handeln und Verantworten, gemeinsam Ideen entwickeln und miteinander umsetzen
- Integration des Individuums in die plurale Gesellschaft, interkultureller Dialog
- Bildende Kunst und Musik als Ausdruck unterschiedlicher Lebensformen und -entwürfe
- Kunstfreiheit nach Art. 5 Grundgesetz
- Reflexion über die Abhängigkeit von Musik und Bildender Kunst von gesellschaftlichen und politischen Bedingungen; Instrumentalisierung von Kunst zur gesellschaftlichen Einflussnahme
- Vielfalt musisch-künstlerischer, gesellschaftlicher und ethischer Aspekte (kulturelle Bildung)
- Stärkung der Individualität und Originalität bei den Arbeits- und Zugangsweisen
- „Individualität – Originalität – Gemeinschaft“
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Schülerinnen- und Schülermentorenprogramme des Kultusministeriums zu Musik und Medien
- Planung, Organisation, Durchführung und Reflexion von Angeboten (z. B. für jüngere Kinder oder für Seniorinnen und Senioren), Konzerten, Ausstellungen, Kulturwochen/interkulturellen Wochen
- themenbezogene Kooperation mit Partnern (Jugendmusikschule, Jugendkunstschule, VHS, Jugendzentrum …)
- Kooperation mit dem Jugendgemeinderat im Rahmen von Städtepartnerschaften (z. B. Konzertreisen, Ausstellungen)
- kooperative Arbeitsformen, gegenseitiges Unterstützen in Übungs- und Gestaltungsprozessen
- Gemeinsames Entwickeln und Abstimmen von Bewertungskriterien
- Musik und Kunstwerke aus verschiedenen Zeiten und Kulturen auf ihre gesellschaftlich-politischen Botschaften und Wirkungen analysieren
- Die Rolle und Stellung von Künstlerinnen und Künstlern in der Gesellschaft
- Arbeiten oder Projektarbeiten zu abstrakten Begriffen wie z. B. Toleranz, Respekt oder Grund- und Menschenrechte
- Theaterarbeit und dortige Auseinandersetzung mit demokratierelevanten Themen und Methoden (Perspektivwechsel, Rollenwechsel, Rollenbiographien ...)
MINT-Fächer und Demokratiebildung

Schnittmengen
Schnittmengen
- naturwissenschaftliche Allgemeinbildung als Voraussetzung für individuelle Urteilsfähigkeit und gesellschaftliche Weiterentwicklung
- Bearbeitung von Zukunftsfragen der Gesellschaft (z. B. Mobilität, Gentechnik, Künstliche Intelligenz)
- Chancen und Risikobewertungen
- Meinungen kontra (datenbasierte) Fakten
- Reflexion der Zusammenhänge zwischen Naturwissenschaft, Technik und Gesellschaft
- beim Umgang mit Medien: vom Konsumierenden zum mündigen Gestaltenden
- globale Probleme und lokales Handeln bzw. individuelles Engagement
- Forschung in Netzwerken und Kooperationen
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Analyse und Erstellung (interessengeleiteter) Statistiken
- Scientific Literacy, Fachbuchreihen in Klassen- und Schülerbüchervereinen, Fachzeitschriften, …
- Technikfolgenabschätzungen (z. B. Kernkraft, Kohlestrom, regenerative Energien)
- ethische Fragen zu naturwissenschaftlichen Themen (z. B. Gendiagnostik, Big Data, Impfungen, Klonen, Künstliche Intelligenz)
- soziale Verantwortung im digitalen Raum (Soziale Medien, Fake News, Datenschutz, Meinungsblasen)
- Forschung zur Nachhaltigkeit (z. B. CO2-Problematik, Elektromobilität, Ressourcenschonung, Recycling, Ökobilanzen)
- Simulationen (z. B. Klimawandel, Erdbevölkerung) und Grenzen
- lokales Engagement (z. B. Petitionen gegen Bienensterben, Parkgestaltung)
- Kooperationen mit verschiedenen Institutionen: z. B. Außerschulische Forschungszentren (AFZ), MINT-EC-Netzwerk, Schüler-Ingenieurs-Akademie, EU-Programm Erasmus+, NaT-Working-Projekte
Angebote der LpB
Netzpolitik
Politik über, mit und durch das Netz
Das Netz geht uns alle an! Von der Breitbandabdeckung über Datenschutz zu Cybermobbing: Dieses Dossier vermittelt ein netzpolitisches Grundverständnis. Es beschreibt aktuelle Entwicklungen wie zum Beispiel die Frage nach Medienkompezent als Unterrichtsfach, erklärt politische Entscheidungen und listet netzpolitische Akteure auf.
Tracing-App gegen Covid-19
Wie funktioniert die technische Corona-Pandemiebekämpfung?
Im europäischen Raum gab es noch nie eine vergleichbare technische Lösung zur Pandemiebekämpfung. Viele ethische und technische Fragen sind aber noch offen: Welche Daten darf eine Tracing-App gegen Covid-19 speichern und weitergeben? Wer kann die Daten sehen? Muss eine solche App freiwillig bleiben? Technische Covid-19-Bekämpfung kann ohne staatliche Überwachung und unter Achtung des Datenschutzes funktionieren. Die Tracing-App einfach erklärt.
mehr
Autonomes Fahren und digitale Ethik
Der Mensch im automatisierten Fahrzeug
Wie soll sich ein „selbstdenkendes“ Fahrzeug im Fall eines Unfalls verhalten? Digitale Ethik kann und muss bei solchen Fragen helfen. Dieses Dossier sensibilisiert für die ethischen Fragen im Bereich der Technikentwicklung und zeigt am konkreten Beispiel autonomen Fahrens, was digitale Ethik ist.
Sachunterricht und Demokratiebildung

Schnittmengen
Schnittmengen
- eigene Gedanken, Gefühle und Eindrücke wahrnehmen und mitteilen
- persönliche Vorlieben, Abneigungen, Stärken, Schwächen, Wünsche und Bedürfnisse und die anderer wahrnehmen, beschreiben und tolerieren
- Empathiefähigkeit entwickeln und Perspektivwechsel vornehmen
- Umgangsformen für das gemeinschaftliches Leben in Klasse und Schule finden, akzeptieren und anwenden
- Gründe und Interessen sozialer Beziehungen erkennen und beschreiben
- sich innerhalb sozialer Beziehungen behaupten und von unerwünschtem Verhalten abgrenzen
- sich Unterstützung holen und geben können
- Gründe für die Entstehung von Konflikten beschreiben und Konfliktlösestrategien erarbeiten, anwenden und bewerten
- Möglichkeiten zum Aufbau von Selbstregulationsstrategien schaffen
- verschiedene Formen des Zusammenlebens beschreiben
- Auseinandersetzung mit verschiedenen kulturellen Lebenswelten und (vertrauten oder fremden) Lebensentwürfen fördern (Identität und Alterität)
- Achtung und Toleranz gegenüber unterschiedlichen individuellen und kulturellen Lebensweisen entwickeln
- die Entwicklung eines dynamischen weltoffenen Heimatverständnisses fördern
- gemeinschaftliches Leben gestalten und Verantwortung übernehmen
- Diskussionsfähigkeit entwickeln (Meinungen begründen und Stellungnahmen formulieren, zuhören, Respekt im Gespräch, usw.)
- Gestaltungs- und Mitbestimmungsprozesse in vielfältigen Situationen erproben und initiieren
- Grundlagen, Strukturen, Aufgaben und Ämter der politischen Ordnung anhand ausgewählter Beispiele beschreiben
- Medienerfahrungen beschreiben, vergleichen und reflektieren
- Umgang mit Medien einüben (z. B. Printmedien, Rundfunk, Fernsehen, Internet)
- Chancen und Risiken digitaler Medien beschreiben
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit (Rollenspiele, Steckbriefe, Lapbooks) schaffen
- Regeln und Rituale im Schulalltag gemeinsam festlegen und umsetzen
- Reflexion über Werte und Normen, die dem Handeln in sozialen Beziehungen zugrunde liegen (z. B. durch philosophisch-ethische Gespräche, die Vorstellungen von einem guten und selbstbestimmten Leben beschreiben, die Spielräume und Grenzen individueller Lebensgestaltung aufweisen, die durch Rollenspiele oder szenischem Spiel verdeutlicht werden können …)
- positive Beispiele (z. B. Aktivitäten für die Klassengemeinschaft, Unterstützung von Schülerinnen und Schülern) thematisieren – von guten Beispielen lernen
- regelmäßiger Umgang mit Konflikten (z. B. Sorgenkasten, Meckerrunde, Neinsagen, Einbezug von Konzepten und Netzwerken…)
- ganzheitliche Möglichkeiten zur wertschätzenden Auseinandersetzung mit kultureller Pluralität (z. B. gemeinsame Ausflüge mit Erziehungsberechtigten, gemeinsame Feste, Informationsaustausch mit Eltern, die verschiedenen Kulturräumen angehören, Begegnungen verschiedener Kulturen bei Festen, Besuch von Kulturvereinen, Interviews mit Familienangehörigen unterschiedlicher Kulturräume …)
- konsequente Einführung und regelmäßige Durchführung eines Klassenrats zu relevanten Themen und Konflikten für die Schülerinnen und Schüler
- Einführung von Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme, z. B. Patenschaften für andere Schülerinnen und Schüler, Beteiligung an Aktionen (Schulfest, Sporttag, Klassenausflug …), Austausch zwischen den Generationen in einem schulartübergreifenden Projekt (z. B. Zusammenarbeit mit einer Seniorenwohnanlage), Kooperation mit Kindertagesstätten …
- Einführung von Möglichkeiten zur Beteiligung an Gestaltungsprozessen (z. B. Beteiligung an Themenentscheidungen, Klassensprecherwahlen, Mehrheitsentscheidungen, kooperative Lernformen …)
- konkrete Erfahrungsfelder zum Aufbau des Verständnisses der politischen Ordnung als Rahmen für Handlungs- und Entscheidungsprozesse ermöglichen (z. B. Besuch des Gemeinderates, Interview des Bürgermeisters, Besuch öffentlicher Institutionen, Rollenspiele, Planspiele, zentrale ausgewählte Grund- und Kinderrechte in Bezug auf konkrete Situationen (in Klasse, Schule, Deutschland und anderen Ländern …)
- aktuelles Zeitgeschehen regelmäßig und kindgerecht in den Unterricht einbeziehen (z. B. Thema der Woche, Frage des Monats, Kindernachrichten ...)
Sprachen und Demokratiebildung: Alte Sprachen

Schnittmengen
Schnittmengen
- Entstehungsbedingungen und Form der Attischen Demokratie
- Zusammenhang von Freiheit und Demokratie
- systematischer Vergleich von Aristokratie – Demokratie – Monarchie im Sinne von Polybios
- Vergleich von Attischer Demokratie und moderner Demokratie
- Rhetorik und Demokratie: Demagogie als demokratiegefährdender Missbrauch der Rhetorik
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Texte von Historikern und Dichtern zum Wesen der Attischen Demokratie und deren Gefährdung und Vergleich mit politischem Handeln in der Gegenwart
- Aufzeigen anhand von textgebundenen Quellen und weiteren Zeugnissen, wie Machtinteressen die Demokratie gefährden
- das Theater als Bildungsstätte für die Demokratie (besonders im Fach Griechisch)
- Darstellung der Entwicklung demokratischen Denkens in der Antike im Überblick
Sprachen und Demokratiebildung: moderne Fremdsprachen

Schnittmengen
Schnittmengen
- Grundkenntnisse der politischen Organisation in unterschiedlichen Ländern
- Auseinandersetzung mit der Geschichte und aktuellen Ereignissen unterschiedlicher Länder sowie deren Beziehung zu Deutschland
- Auseinandersetzung mit Themen wie Menschenrechte, internationale Konflikte, Friedensbildung, internationale Zusammenarbeit
- Teilhabe am interkulturellen Dialog
- kulturspezifische Verhaltensweisen verstehen und berücksichtigen; sich in interkulturellen Kontexten angemessen verhalten
- eine sensible Gesprächs- und Diskussionskultur erlernen (sich höflich und adressatengerecht an Gesprächen beteiligen, in angemessener Form Kritik üben, die eigene Meinung darlegen, Kompromisse aushandeln, seinen Standpunkt vertreten)
- literarische und filmische Zugänge zu unterschiedlichen Lebenskonzepten und -bedingungen
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Diskussionen und Debatten zu aktuellen und altersgerechten Themen (z. B. soziale Medien, Migration, nationale vs. globale Interessen, Konsumverhalten, EU, europäische Identität)
- Aufgaben, die einen Perspektivwechsel beinhalten (z. B. Rollenspiele, Simulationen)
- parlamentarische Debatten ansehen und auswerten
- politische Texte analysieren und dazu Stellung nehmen
- Möglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Partizipation recherchieren, präsentieren und ggf. ausprobieren (z. B. NGOs, Ehrenamt, verantwortungsbewusster Konsum, eine Kampagne planen, Teilnahme als Mitglied einer Jugenddelegation für Plenarsitzung KGRE: Teilnahme an europäischem Jugendevent des Europäischen Parlarments)
- Erasmus+-Projekte, eTwinning-Projekte

Europa im Unterricht
Informationen und Unterrichtsmaterialien zur EU und zu Europa
Wie ist die EU aufgebaut? Und wo finden Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien zur EU und zu Europa? Das Portal „Europa im Unterricht“ liefert umfangreiche Informationen.
Religionslehre, Ethik und Demokratiebildung

Schnittmengen
- Menschenrechte und Menschenwürde (z. B. Gottebenbildlichkeit und Aufklärungsgedanke)
- Vergleich von Wert- und Normvorstellungen (z. B. inter- oder intrakulturell, religiös, historisch)
- Achtung Andersdenkender oder -gläubiger als grundlegendes Prinzip
- Glaubens- und Gewissensfreiheit nach Art. 4 Grundgesetz und mögliche Spannungsfelder
- Handlungsmöglichkeiten für einen wertorientierten Umgang miteinander
- Vorstellungen von einem guten Lebens für alle
- Regeln und Regelverstöße
- Modelle beispielhaften Verhaltens
- Handlungsmöglichkeiten in Konfliktsituationen
- unterschiedliche Formen von Gerechtigkeit (Chancengleichheit, Gleichberechtigung, Nachteilsausgleich)
- Formen von Freiheit
- Freiheit und Verantwortung
- Grenzen der Toleranz
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Planspiel zur Bergpredigt („Die Bergpredigt-Insel“)
- das Gleichnis vom barmherzigen Samariter handlungsorientiert umsetzen (Comic, Rollenspiel, Zeitungsartikel, Filmteaser)
- Janne Teller: Krieg, stell dir vor, er wäre hier (Verlust von Grundrechten in einem europäischen Land, Flucht auf den afrikanischen Kontinent, Asyl, Neuanfang , Auseinandersetzung mit ethischen Fragen ...), ab 7. Klasse
- Margaret Atwood: Der Report der Magd (Dystopie), Reduzierung der Frauen aufs Gebären, Machtstrukturen in einem Polizeistaat, Verlust der Grundrechte, Diktatur, Folter ..., ab 10. Klasse
- „All that we share“ (Videoclip), Erfahrung von Diversität und Gemeinsamkeiten
- Spiele zu Gerechtigkeit (Schicksalslotto), Kommunikation (Moonies und Sunnies), alle Klassenstufen
- Stéphane Hessel, Empört euch! (Aufforderung zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit)
- Hans Jonas, Verantwortungsethik (Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Mensch und Umwelt, Verantwortungsbegriff, verantwortungsethischer Imperativ)
- Martha Nussbaum, Fähigkeiten schaffen (Auseinandersetzung mit Wegen zur Verbesserung der Lebensqualität)
- Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden (Anwendung seiner Moralphilosophie auf die Politik)
- Römerbrief (13) und Markus (12): Auseinandersetzung mit deren Wirkungsgeschichte
- Dalai Lama, Ethik ist wichtiger als Religion (Auseinandersetzung mit ethischen Werten für das Zusammenleben)
Angebote der LpB BW
Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg
Unterrichtsmaterialien, Beratung, Informationen und Qualifizierung
Sport und Demokratiebildung

Schnittmengen
- Fairness – Rücksichtnahme – Respekt – Unterstützung
- Selbstregulationsfähigkeit (z. B. Regulation von Gedanken, Emotionen und Handlungen)
- regelbasiertes Verhalten (Erarbeiten, Kennen und Einhalten von Regeln)
- Umgang mit Erfolg und Misserfolg, Bewältigung von Konfliktsituationen
- Einbringen in Gruppenprozesse, Anerkennung der eigenen Leistung und der anderer
- Kooperation, Dialog und Zusammenarbeit
- selbstständiges Planen, Handeln und Verantworten, gemeinsam Ideen entwickeln und umsetzen
- Reflexion über die Abhängigkeit des Sports von gesellschaftlichen und politischen Bedingungen und Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Rolle von Sport
- Reflexion über den Einfluss der medialen Welt (z. B. Berichterstattung)
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Projekttage und -wochen (auch fächerübergreifende Projekte) gemeinsam planen und durchführen
- Schülermentorenprogramm des Kultusministeriums für Sport
- Planung, Organisation, Durchführung und Reflexion von Bewegungs-und Betreuungsangeboten, Sporttagen, Wandertagen, Turnieren/Fair-Play-Turnieren samt Schiedsrichtertätigkeiten und Fair-Play-Preisen
- Beteiligung an der Planung eines sport- und bewegungsfreundlichen Pausenhofs
- kooperative Spiele
- Spielen/Spiele ohne Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter
- Spiele, Tänze und Sportarten aus anderen Ländern und Kulturen
- Diskussionen über Austragung von internationalen Sportwettbewerben und Großveranstaltungen
- Vergleich unterschiedlicher Medien und Quellen der Berichterstattung und Kommentierung von Sportereignissen
- Sport-SMV mit demokratischen Strukturen, Partizipation bei der Aufstellung der Angebote im außerunterrichtlichen Schulsport
- Kooperation mit dem Jugendgemeinderat im Rahmen von Städtepartnerschaften (z. B. Wettkämpfe)
Weitere Links zu den Angeboten der LpB BW
LpB nach Themen
Unter diesen Links finden Sie Hintergrundberichte, Veranstaltungen und Publikationen der Landeszentrale für politische Bildung zu folgenden Themen
Wirtschaft und Demokratiebildung

Schnittmengen
Schnittmengen
- die Lebenssituation von Wirtschaftsbürgerinnen und -bürgern, die Einfluss auf die Gestaltung der Wirtschaftsordnung nehmen können und sollen
- analoge und digitale Partizipationsmöglichkeiten sowohl in der Lebenssituation als Wirtschaftsbürgerin und -bürger als auch als Konsumentin und Konsument
- Interessen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in einer pluralen Gesellschaft
- Konflikte zwischen Akteuren in einer Wirtschaftsordnung demokratisch austragen
- die Rolle von souveränen Konsumenten als aufgeklärte Demokratinnen und Demokraten
- Freiheit bei der Berufswahl als Grundrecht
Anregungen und Impulse
Anregungen und Impulse
- Gestaltung von Plakaten, Entwicklung von kurzen Filmsequenzen oder Präsentationen für oder gegen ein Freihandelsabkommen
- Kaufgespräche oder Social-Media-Beiträge unter demokratischen Gesprächsregeln
- Podiums- oder Expertengespräche mit Akteurinnen und Akteuren aus der Arbeitswelt (Stakeholder) über mögliche Konflikte und Konfliktlösungen
- Überlegungen zum Diversity Management
- Dilemmadiskussionen zum Verhalten von Akteurinnen und Akteuren auf dem Kapital- und Finanzmarkt
- Spannungsfelder zwischen Gewinnmaximierung und Unternehmensethik
- Gedankenexperimente und Modellentwicklung zur idealen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung
- Rollenspiele zu Tarifkonflikten, Ansiedlung von Unternehmen
- Planspiel zum Lobbyismus am Beispiel der Reform der Krankenversicherung (www.lpb-bw.de)
Good Practice - Beispiele für Demokratiebildung
So gelingt Demokratiebildung!

aula: Online-gestütztes Beteiligungskonzept mit didaktischer Begleitung
aula: Online-gestütztes Beteiligungskonzept mit didaktischer Begleitung
aula ist ein Projekt von politik-digital e. V. und wurde mit Unterstützung der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt. aula bietet Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen ein Beteiligungstool, mit dem sie eigene Ideen für die Gestaltung ihres Schulumfelds entwickeln, Mehrheiten dafür suchen und in die Schulentwicklung einbringen können.
mehr dazu auf https://aula-blog.website/
BiBaWu: Bildungspartnerschaft Baden-Württemberg im Unterricht
BiBaWu: Bildungspartnerschaft Baden-Württemberg im Unterricht
Die Konzeption Bildungspartnerschaft Baden-Württemberg im Unterricht (BiBaWU) soll die Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen Lernorten und Institutionen (Archiven, Gedenkstätten, Museen ...) verstetigen und Anregungen sowie Hilfestellungen zu Standards, Methoden und Finanzierungsmöglichkeiten dieser Bildungspartnerschaften bieten.
mehr dazu auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Deichmann-Förderpreis für Integration
Deichmann-Förderpreis für Integration
Mit dem Deichmann-Förderpreis für Integration werden u. a. Schulen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund bemühen.
mehr dazu auf www.deichmann-foerderpreis.de
DemokratieErleben: Preis der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe)
DemokratieErleben: Preis der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe)
Der Preis für demokratische Schulentwicklung wird seit 2015 vergeben. Ausgezeichnet werden Schulen, die definierte Qualitätsstandards in alle Bereiche des Schullebens integrieren.
mehr dazu auf der Webseite der DeGeDe
DEVI e. V.: Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher Bildung
DEVI e. V.: Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher Bildung
DEVI e. V. führt Projekte durch zur Stärkung von Demokratie und Vielfalt sowie gegen Rechtsextremismus, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Diskriminierungen und religiös begründeten Extremismus. Der Verein stellt auf seiner Webseite Einzelprojekte sowie ein Auditverfahren im Kontext von Antidiskriminierung als Instrument schulinterner Qualitätsentwicklung vor.
mehr dazu auf www.demokratieundvielfalt.de/projekte
Europäischer Wettbewerb
Europäischer Wettbewerb
Träger des Europäischen Wettbewerbs ist der Verein Europäische Bewegung in Deutschland e. V.; gefördert wird der Wettbewerb u. a. durch die Kultusministerkonferenz.
Schülerinnen und Schüler oder Schulklassen aller Altersstufen können Beiträge zu aktuellen europäischen Themen einreichen (Bilder, Fotos, Collagen, Bücher, Texte, Essays, Reden, Videoclips und Trickfilme, Interviews, Comics, Musikstücke, Medienkampagnen und Onlinebeiträge). Die Schülerarbeiten vergangener Wettbewerbe können eingesehen werden und geben Impulse für eine kreative Auseinandersetzung mit dem Thema „Europa“.
mehr dazu auf www.europaeischer-wettbewerb.de
Jugend debattiert
Jugend debattiert
„Jugend debattiert“ soll Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab Klasse 5 ermutigen, durch Debattentraining ihre sprachliche, politische und persönliche Bildung zu verbessern und so einen Beitrag zu einer lebendigen und respektvollen Streitkultur zu leisten.
mehr dazu auf www.jugend-debattiert.de
Juniorwahl
Juniorwahl
Im Rahmen von Landtags-, Bundestags- und Europawahlen werden Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler unterstützt, eine realitätsgetreue Wahlsimulation an ihrer Schule zu organisieren und durchzuführen. Zudem gibt es Unterrichtsmaterial sowie alle Wahlunterlagen, die für die Juniorwahl nötig sind.
mehr dazu auf www.juniorwahl.de
Lernen durch Engagement
Lernen durch Engagement
Auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg gibt es eine Sammlung von Praxisbeispielen zum Lernen durch Engagement von Schulen aus Baden-Württemberg.
mehr dazu auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Medienbildung in der Grundschule – Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)
Medienbildung in der Grundschule – Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ)
Die Praxisbeispiele für Medienbildung in der Grundschule zeigen, wie Medienbildung mit Inhalten des Leitfadens in unterschiedlichen Fächern und fächerübergreifenden Projekten verzahnt werden können.
mehr dazu auf der Webseite des LMZ
Modellschulen für Partizipation und Demokratie in Rheinland-Pfalz
Modellschulen für Partizipation und Demokratie in Rheinland-Pfalz
Es gibt eine Sammlung von Praxisbeispielen der teilnehmenden Modellschulen zu Aspekten einer demokratischen Schulentwicklung, u. a. zu Themen wie Elternbeteiligung, Partizipation beim Lernen, Peer-Learning, Gewaltprävention.
mehr dazu auf www.modellschulen-partizipation.de
Praxisbeispiele für schulische Antidiskriminierungsprojekte der Antidiskriminierungsstelle
Praxisbeispiele für schulische Antidiskriminierungsprojekte der Antidiskriminierungsstelle
Die Broschüre der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sammelt Beiträge des Wettbewerbs „fair@school – Schulen gegen Diskriminierung“, d. h. Antidiskriminierungsprojekte unterschiedlicher Altersstufen und Schularten.
mehr dazu auf der Webseite der Antidiskriminierungsstelle
Simulation „Schule als Staat“
Simulation „Schule als Staat“
Zur Simulation „Schule als Staat“ stehen online vertiefende Informationen und Projektdokumentationen von Schulen in Baden-Württemberg zur Verfügung.
mehr dazu auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Praxisbeispiele der Stiftung Bildung und Gesellschaft
Praxisbeispiele der Stiftung Bildung und Gesellschaft
Die Stiftung Bildung und Gesellschaft stellt Praxisbeispiele für Demokratiebildung aus unterschiedlichen Schularten vor. Die Projekte stärken das gesellschaftliche Engagement von Kindern und Jugendlichen, fördern die Teilnahme an politischen Prozessen und setzen sich für Völkerverständigung ein. Viele der Beispiele beziehen dabei außerschulische Partner ein.
mehr dazu auf der Webseite der Stiftung Bildung und Gesellschaft
UNESCO-Projektschulen
UNESCO-Projektschulen
Die UNESCO-Projektschulen in Baden-Württemberg setzen Schwerpunkte u. a. im Bereich der Menschenrechtsbildung, Demokratiebildung und Werteerziehung. UNESCO stellt exemplarische Porträts von UNESCO-Projektschulen in Baden-Württemberg vor.
mehr dazu auf der Webseite der UNESCO
World LAB: Projekt für berufliche Schulen
World LAB: Projekt für berufliche Schulen
Das World LAB ist ein Kooperationsprojekt der Stiftung Weltethos mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und wird von der Robert Bosch Stiftung sowie von Engagement Global gefördert. Das World LAB bringt Jugendliche aus Vorbereitungs- und Regelklassen an beruflichen Schulen zusammen, um sich mit gemeinsamen Werten zu beschäftigen. Junge Menschen sollen durch das Projekt zu einer offenen, wertschätzenden und reflektierenden Haltung befähigt werden.
mehr dazu auf der Webseite der Robert-Bosch-Stiftung





